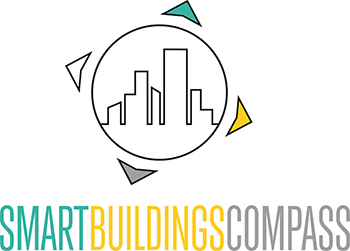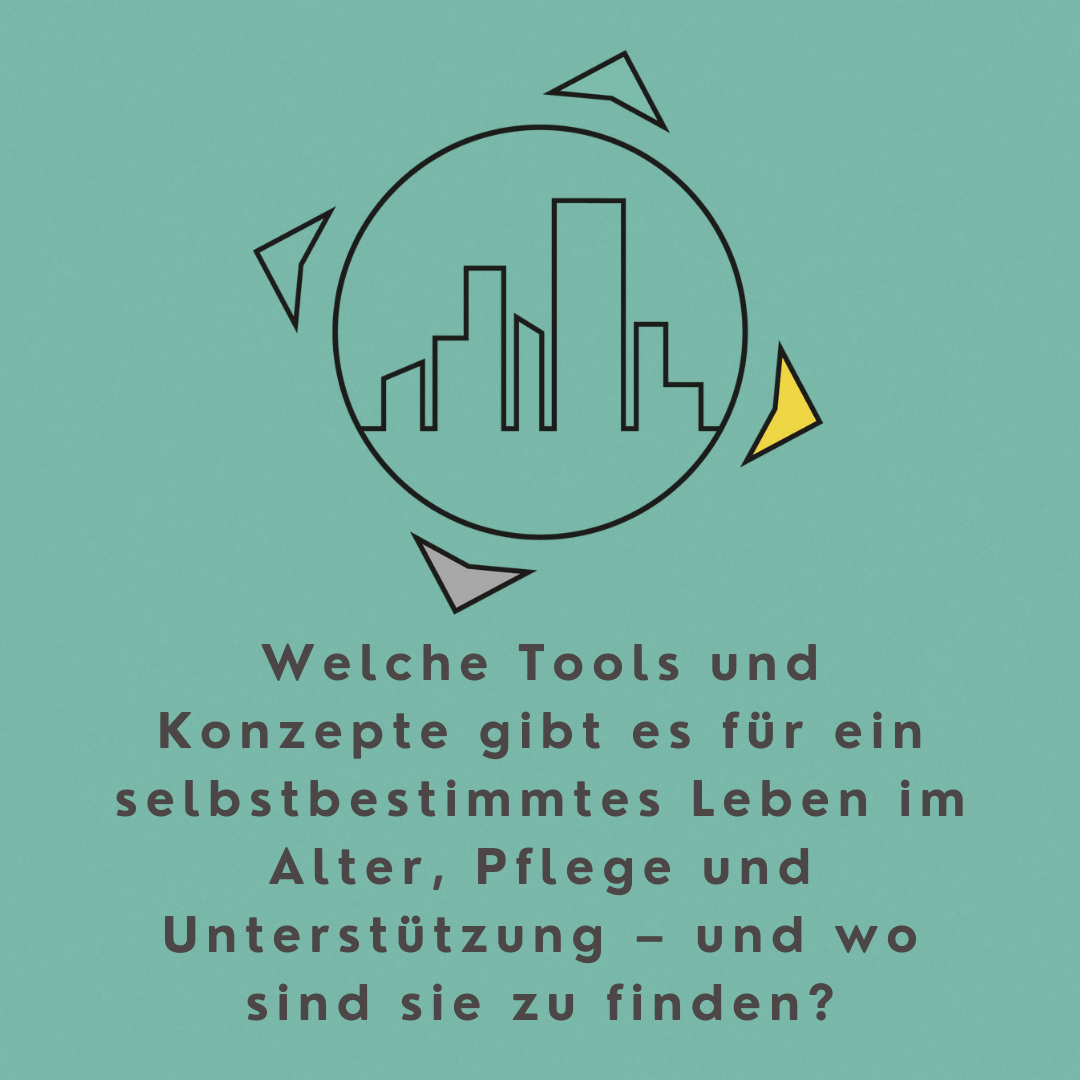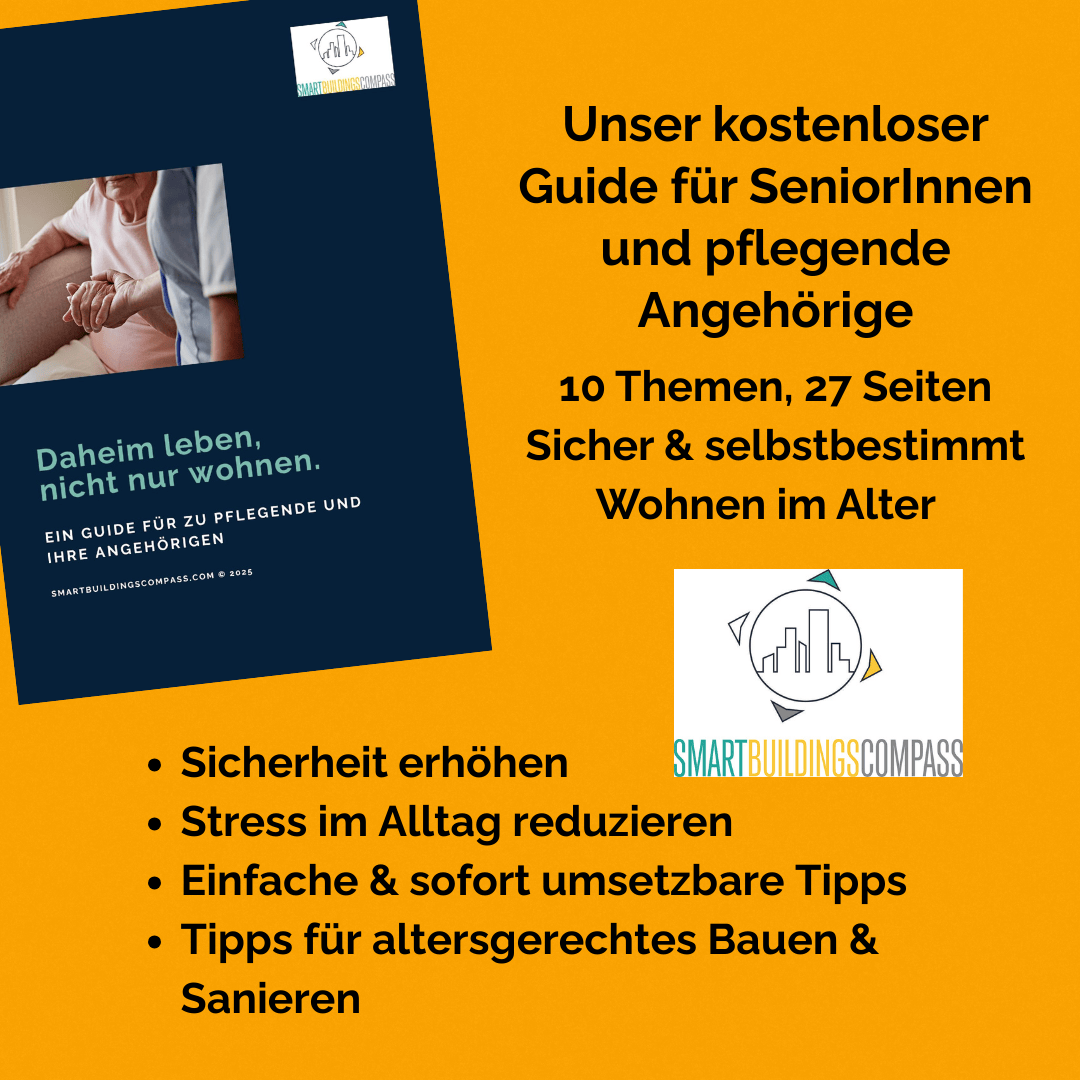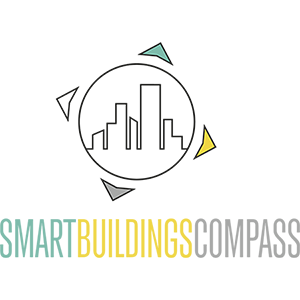This article is also available in:
English
Elisabeth Potzmann, Präsidentin des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbands, bringt langjährige Erfahrung aus Intensivpflege und Pflegepädagogik mit. Im Interview sprechen wir mit ihr über zwei zentrale Baustellen der Krisenvorsorge: Warum ein Pflegeregister als Grundlage für gezielte Unterstützung fehlt – und weshalb das Berufsbild der `Disaster Nurse´ in Österreich dringend in der zivilen Versorgungsstruktur verankert werden sollte.
Krisen sind auch nicht immer großflächig – oft sind sie ganz persönlich. Wohin können sich Familien wenden, wenn kurzfristig Kurzzeitpflege oder eine Übergangslösung gebraucht wird?
SBC: Wie ordnen Sie das Thema Katastrophenpflege ein – und warum braucht es aus Ihrer Sicht in Österreich künftig klarere Strukturen in der zivilen Gesundheitsversorgung?
Potzmann: Für uns ist das kein Einzelthema, sondern eingebettet in den großen Zusammenhang Klima und Gesundheit – und das ist auch einer der zentralen Schwerpunkte des ÖGKV für 2026. Wir haben im Herbst bereits damit begonnen, unter anderem mit der Planetary Health Charter, die wir bei der gleichnamigen Konferenz in Pinkafeld vorgestellt haben. Und daraus ergibt sich für uns als Gesundheitsberuf ganz konkret die Frage: Was bedeutet das für die Praxis – für Pflege, Versorgung und Einsatzfähigkeit, wenn Krisen häufiger werden?
Denn wir sprechen längst nicht nur über `den´ Blackout. Es geht um unterschiedlichste Großereignisse, die alle in dieselbe Richtung zeigen: Katastrophenpflege und Katastrophenmanagement. Das können Großwetterlagen sein – Hochwasser, Stürme, aber auch Hitze. Gerade Hitze ist in Österreich ein unterschätztes Risiko, nicht zuletzt für Menschen, die zu Hause gepflegt werden. Dazu kommen Einzelereignisse, die ganze Systeme belasten: Massenanfälle von Verletzten, etwa durch ein School Shooting wie in Graz, oder tragische Brände wie zuletzt in der Schweiz. Und natürlich auch infrastrukturelle Störungen wie ein großer Stromausfall – ob regional oder großflächig.
Was wir dabei sehen: Bei den Einsatzkräften sind wir vergleichsweise gut organisiert – Rotes Kreuz, Bundesheer, klassische Blaulichtstrukturen. Aber in der zivilen Gesundheits- und Versorgungsstruktur sind wir deutlich schlechter aufgestellt, sowohl organisatorisch als auch in der Ausbildung. Da gibt es zu wenig systematisches Wissen, zu wenig klare Rollen, zu wenig verankerte Zuständigkeiten.
>> Bei den Einsatzkräften sind wir vergleichsweise gut organisiert – Rotes Kreuz, Bundesheer, klassische Blaulichtstrukturen. Aber in der zivilen Gesundheits- und Versorgungsstruktur sind wir deutlich schlechter aufgestellt, sowohl organisatorisch als auch in der Ausbildung. <<
Oft wird mit dem Prinzip Hoffnung gearbeitet, und es wird schon `jemand Engagiertes im Dienst sein` der sich kümmert. Ja, punktuell gibt es Menschen mit Spezialausbildung. Aber wir wissen oft nicht einmal: Wer ist das? Wo sind diese Personen? Und vor allem: Es gibt keine durchgängige Struktur, die sicherstellt, dass in jeder Versorgungseinrichtung – Krankenhaus, Langzeitpflege, mobile Dienste – jemand vorhanden ist, der im Krisenfall koordinieren kann und auch die Sprache der Einsatzorganisationen versteht.
Genau dafür gibt es in der Pflege ein etabliertes Berufsbild: Die Disaster Nurse, also die Katastrophenpflege. Unser Ziel ist, dieses Profil in der zivilen Versorgungsstruktur zu verankern, dass es in jeder Einrichtung eine klar benannte, geschulte Person gibt, die im Ereignisfall koordiniert, Schnittstellen managt und rasch in eine Führungs- und Umsetzungslogik kommt.
Denn im Moment leben wir davon, dass Menschen im Ernstfall einfach bleiben und helfen so gut es geht. Aber das kann nicht unser Systemkonzept sein: Dass Menschen einen oder zwei Tage länger bleiben und wir darauf hoffen, dass sich andere, die frei haben, irgendwie einfinden. Das funktioniert einmal, vielleicht auch ein zweites Mal. Aber wenn Ereignisse häufiger werden – und genau das ist angesichts von mehr Hochwasserlagen und mehr Hitzewellen realistisch –, dann wird dieses Prinzip irgendwann brechen. Menschen sind ja selbst betroffen: Sie haben Familien, Kinder, Angehörige, sie müssen nach Hause, sie müssen sich selbst schützen.
Und genau deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir aus `Hoffen´ Struktur machen – und aus spontaner Improvisation planbare, trainierte Handlungsfähigkeit. Die Pflege ist in diesen Strukturplänen leider noch nicht überall mitgedacht und abgebildet.

SBC: Das Prinzip Hoffnung gilt in Krisen grundsätzlich für ältere Menschen und für diejenigen, die medizinische Unterstützung benötigen – denn es gibt kein durchgängiges Pflegeregister. Wo sehen sie hier Handlungsbedarf?
Potzmann: Aus meiner Sicht ist das Grundproblem ganz banal: Die Awareness ist kaum vorhanden. Solange nichts passiert, fühlt es sich für viele wie ein Thema für später an. Und genau da zeigt sich ein zweiter, sehr praktischer blinder Fleck – Berlin hat das deutlich gemacht: Wir wissen im Ereignisfall oft gar nicht, wo Menschen sind, die akut Hilfe brauchen. Natürlich: Wer bereits in Betreuungssystemen ist – etwa über Rotes Kreuz, Hilfswerk oder andere Anbieter – ist im Idealfall erfasst, und diese Organisationen können ihre KlientInnen grundsätzlich abfragen. Aber sehr viele Menschen fallen durch dieses Raster, weil sie noch von Angehörigen versorgt werden, weil sie gerade noch allein zurechtkommen – und dann in einer Krise plötzlich nicht mehr.
>> Wir wissen im Ereignisfall oft gar nicht, wo Menschen sind, die akut Hilfe brauchen. <<
Ein klassisches Beispiel: Jemand wohnt im dritten Stock, der Lift fällt aus, das Telefon funktioniert nicht verlässlich, die Wege sind zu mühsam – und auf einmal wird aus einem geht schon irgendwie eine Situation, die ohne Unterstützung nicht mehr handhabbar ist.
Genau deshalb halte ich die Idee eines Pflegeregisters für so wichtig. Es gibt dazu bereits Vorbilder – etwa in Deutschland, wo Angehörige Menschen eintragen können, wenn sie weit entfernt wohnen und im Ernstfall nicht schnell vor Ort sein können. Der Gedanke dahinter ist simpel: Einsatzorganisationen sollen zumindest wissen, dass dort jemand ist, der besondere Bedürfnisse hat – zum Beispiel insulinpflichtig ist, im Winter ohne Heizung gefährdet wäre oder schlicht nicht mobil genug ist, um sich selbst in Sicherheit zu bringen. Dann kann man im Krisenfall gezielt nach dem Rechten sehen – oder im Extremfall Menschen in einen warmen, sicheren Ort bringen.
Dafür braucht es zuerst eine politische Entscheidung, dass ein Pflegeregister überhaupt aufgebaut werden soll – inklusive Finanzierung und einer klaren Zuständigkeit. Ohne diesen Auftrag bleibt es bei einer Idee, weil Betrieb, Wartung und Datenschutz-konformität Ressourcen benötigen.
Parallel dazu muss festgelegt werden, wer dieses Register trägt. Da es um sensible Daten geht, braucht es eine Institution, der Menschen vertrauen und bei der sie bereit sind, solche Informationen zu hinterlegen. Aus praktischer Sicht wird das nur funktionieren, wenn die Trägerschaft auf einer Ebene liegt, die als legitim und verlässlich wahrgenommen wird – etwa staatlich oder bei einer sehr etablierten Organisation, die in der Bevölkerung breite Akzeptanz genießt.
Der schwierigste Schritt kommt danach: Aus dem Wissen muss eine handlungsfähige Struktur werden. Sobald man weiß, wo pflege- und betreuungsbedürftige Menschen sind, stellt sich im Ereignisfall zwingend die Frage, wer konkret zuständig ist, wer wann hinfährt, wie priorisiert wird und welche Unterstützung realistisch geleistet werden kann. Genau diese Umsetzungsverantwortung – vor allem auf Länder- und Gemeindeebene – ist der Punkt, der am meisten Organisation, Ressourcen und klare Abläufe erfordert. Ohne diese operative Logik wäre ein Register zwar vorhanden, aber im Ernstfall nicht wirksam.
>>Der schwierigste Schritt kommt danach: Aus dem Wissen muss eine handlungsfähige Struktur werden. Sobald man weiß, wo pflege- und betreuungsbedürftige Menschen sind, stellt sich im Ereignisfall zwingend die Frage, wer konkret zuständig ist, wer wann hinfährt, wie priorisiert wird und welche Unterstützung realistisch geleistet werden kann.<<
SBC: Krisen sind nicht immer großflächig, sondern sehr persönlich. Wie kann man sich eigentlich vorbereiten, wenn man kurzfristig Entlastung braucht, zum Beispiel durch Kurzzeitpflege? Ich habe gelesen, dass es in Krisen- oder Überforderungssituationen zu Spitals-Einweisungen kommt, weil Familien schlicht nicht mehr wissen, wie sie eine Pflege zu Hause organisieren sollen.
Potzmann: Solche Aufnahmen aus sozialer Indikation, also weil die Versorgung zu Hause gerade nicht möglich ist, gab es früher deutlich häufiger, vor allem vor der Pandemie. Heute passiert eher das Gegenteil: Menschen werden teils früher entlassen, als man es früher für vertretbar gehalten hätte – manchmal sogar mit komplexen Versorgungsbedarfen wie Katheter oder Beatmung. Und genau das bringt Familien und auch die 24-Stunden-Betreuung zunehmend an ihre Grenzen. Es ist spürbar: Da ist derzeit einiges im Argen – und die passenden Strukturen fehlen noch.
Gleichzeitig gibt es Bewegung: Niederösterreich startet gerade damit, pflegegeführte Zwischenstrukturen aufzubauen – sogenannte nurse-led-units, also pflegegeführte Einheiten, Stationen und Kliniken. Die Idee dahinter: Menschen, die nicht mehr ins Spital gehören, aber für zu Hause noch nicht stabil genug sind, weil sie noch Training, Übergangspflege oder schlicht ein sicheres Setting brauchen, sollen dort gezielt aufgefangen werden. Auch Situationen, in denen Betreuungspersonen plötzlich ausfallen, könnten so überbrückt werden, ohne dass man dafür ein Krankenhausbett zweckentfremden muss.
Spannend fand ich auch den größeren Gedanken dahinter: Wenn sich die Krankenhauslandschaft verändert, muss das nicht automatisch eine Schließung bedeuten – es kann auch heißen, mit diesem Umbau in neue Versorgungsformen genau diese Lücke zwischen Akutspital und häuslicher Versorgung zu schließen. Das ist international durchaus üblich.
In der öffentlichen Kommunikation geht es oft sehr stark um Zuständigkeiten, Finanzierung und wer an Bord ist. Für Betroffene zählt aber etwas anderes: Dass es eine funktionierende, verständliche Unterstützung gibt, wenn jemand aus dem Spital kommt und der Alltag zu Hause noch nicht trägt. Genau diese Perspektive möchte ich im nächsten Schritt stärker sichtbar machen.
Vielen Dank für das Interview!
Author: Anja Herberth
Chefredakteurin