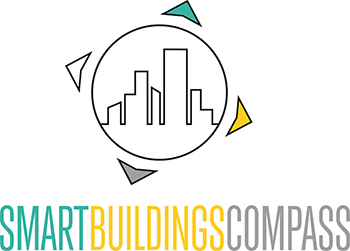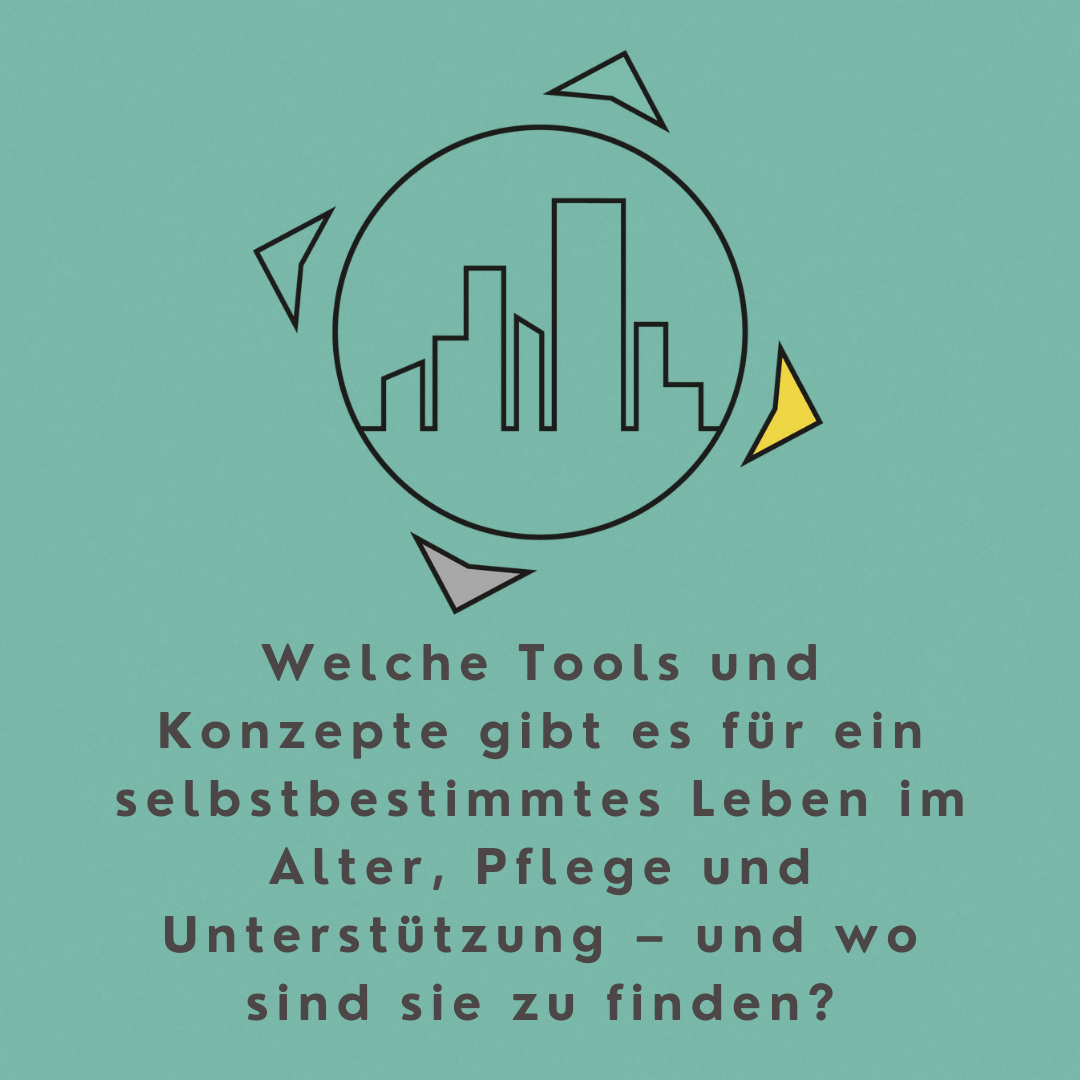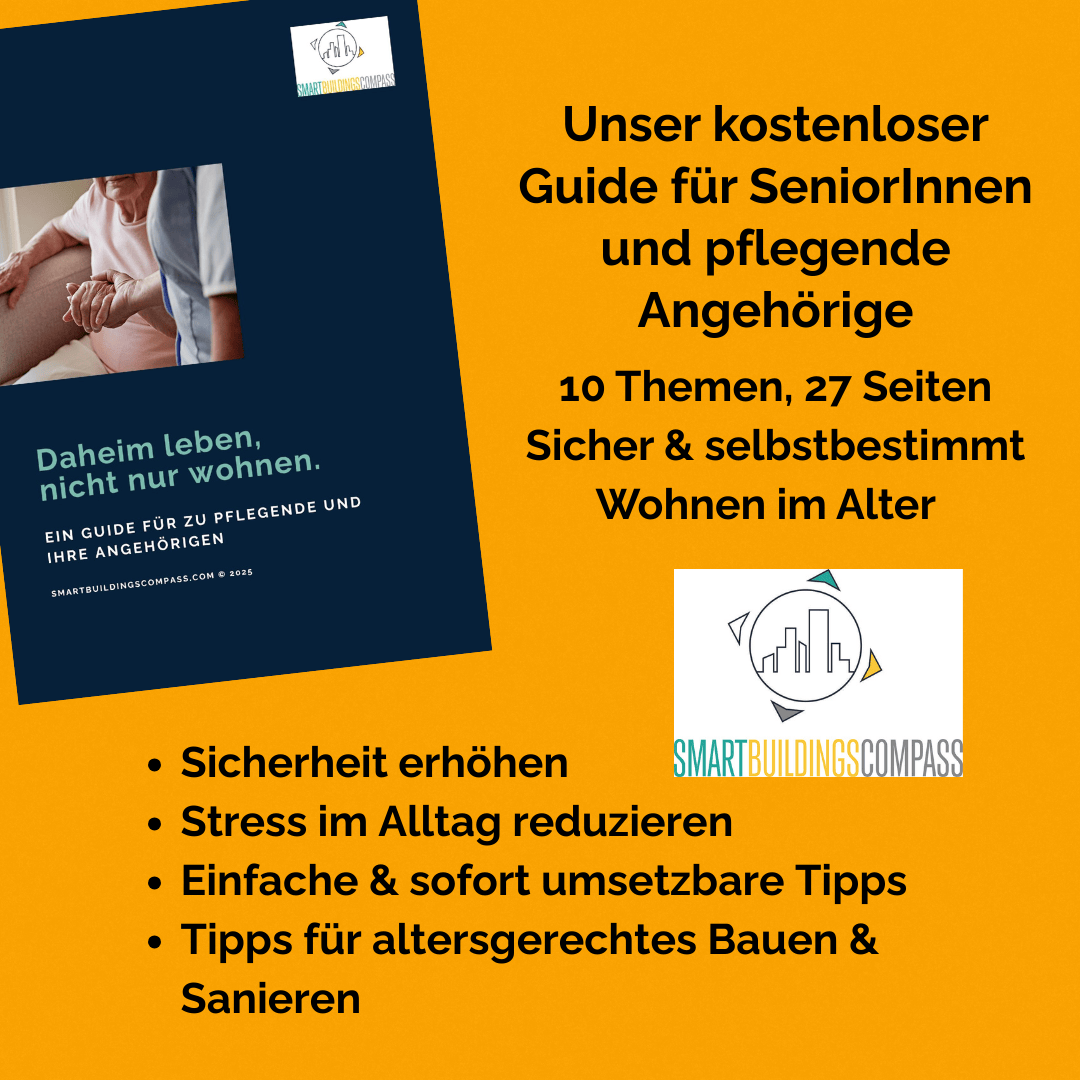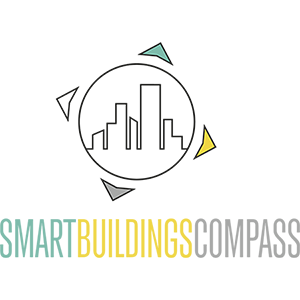Schwester Cornelia von der Kongregation der Franziskanerinnen Salzkotten (Nordrhein-Westfalen) verantwortet das Krisenmanagement ihrer Gemeinschaft – und bringt darüber hinaus Erfahrung aus bundesweiten Projektgruppen zur Krisenvorsorge ein. Als Gründungsmitglied der BIVG, der deutschen Bundesinitiative für Vernetzte Gefahrenabwehr, kennt sie die Schnittstellen zwischen Versorgung, Behörden und Einsatzorganisationen aus nächster Nähe. Die Kongregation betreibt zwei stationäre Pflegeeinrichtungen, weiters werden Räumlichkeiten für einen angrenzenden Kindergarten zur Verfügung gestellt.
Im Interview sprechen wir über zentrale Learnings aus dieser Arbeit und Sr. Cornelia erklärt, welche einfachen, alltagstauglichen Schritte älteren Menschen und pflegenden Angehörigen wirklich helfen können: Von Absprachen mit Apotheke und Hausarzt über Medikamentenpläne bis hin zu der Frage, wie Nachbarschaft im Ernstfall zur entscheidenden Sicherheitslinie wird. Ein Gespräch über praktische Handlungsfähigkeit – und über Verantwortung, die dort beginnt, wo wir nicht nur an uns selbst denken.
SBC: Krisenpläne richten den Blick oft besonders auf vulnerable Gruppen. Sie verantworten das Krisenmanagement in Ihrer Organisation und haben damit einen sehr praxisnahen Zugang. Wie definieren Sie in Ihrer Arbeit `vulnerabel´ – und wie sind Sie bei der Planung konkret an die Bedürfnisse dieser Menschen herangegangen?
Sr. Cornelia: Neben älteren Menschen zählen typischerweise auch chronisch Kranke, pflegebedürftige Personen, Menschen mit Beeinträchtigungen – körperlich, kognitiv oder psychisch – sowie Menschen in besonderen Lebenslagen dazu. Das sind etwa Alleinstehende, Personen mit geringem Einkommen, Obdachlose oder Geflüchtete. Auch Menschen, die auf lebenserhaltende oder stromabhängige Geräte angewiesen sind, wie etwa Beatmung, Sauerstoffversorgung oder ähnliche Medizintechnik, gehören für mich ganz klar in diese Kategorie.
`Vulnerabilität´ ist eben nicht nur eine Frage des Alters, sondern auch der gesundheitlichen Situation, der sozialen Einbettung und der praktischen Handlungsfähigkeit im Alltag. Und genau da liegt für mich auch die Brücke zu Ihrem Schwerpunkt Pflege zu Hause: In stationären Einrichtungen sind Krisenpläne, Routinen und Zuständigkeiten meist vorhanden – im häuslichen Umfeld ist das deutlich schwieriger. Dort wird Vorsorge häufig sehr allgemein gedacht, aber das wirklich Knifflige beginnt bei Pflege im engeren Sinn: Medikamente, komplexe Einschränkungen, Demenz, Mobilität, Kommunikationsausfall, Abhängigkeit von Unterstützung.
Deshalb finde ich Ihren erweiterten Blick auf vulnerable Gruppen auch strategisch sinnvoll: Aus anderen Bereichen, etwa im Umgang mit psychischen Beeinträchtigungen oder mit sozialen Risikolagen, gibt es möglicherweise Konzepte, die sich als Benchmark oder Baustein für die häusliche Pflege nutzen lassen. Gerade weil vieles hier noch nicht ausreichend konkretisiert ist, lohnt sich dieser Transfer.
Und noch ein Punkt, der mir wichtig ist: Der Blackout ist gerade ein sehr präsentes Szenario – aber er ist nicht das einzige. Klimawandelbedingte Ereignisse wie Fluten, Stürme oder Hitzeperioden sind mindestens genauso relevant, ebenso lokale Lagen wie starke Winterereignisse oder Infrastrukturstörungen. Genau deshalb ist es sinnvoll, Krisenvorsorge nicht als `ein´ Ereignis zu betrachten, sondern als Fähigkeit, in unterschiedlichen Szenarien handlungsfähig zu bleiben.
Ich weiß nicht, wie präsent das in Österreich gerade ist – aber in Deutschland gab es zuletzt durch enorme Schneemassen wieder etliche Haushalte, die plötzlich ohne Strom dastanden. Solche Lagen sind für mich immer ein Anlass, kurz innezuhalten und zu reflektieren: Der `Blackout´ ist oft nicht der Anfang, sondern eher das Endprodukt einer Kette von Ereignissen. Viele unterschiedliche Szenarien können am Ende in dieselbe Richtung kippen – und genau deshalb ist es mir wichtig, die Vorsorge nicht nur auf das eine große Ereignis zu verengen, sondern im Zusammenhang zu denken.
SBC: Wenn ich mich als ältere, vulnerable Person auf Krisen vorbereiten möchte – oder als pflegende Angehörige Verantwortung mittrage: Welche Informationsquellen und Anlaufstellen empfehlen Sie?
Sr. Cornelia: Was ich ganz konkret empfehlen kann: In Deutschland ist die Broschüre `Vorsorge für Krisen und Katastrophen´ des deutschen Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wirklich sehr gut. Sie ist kürzlich aktualisiert worden und für den häuslichen Bedarf extrem praktisch. Da ist alles enthalten – von der Bevorratung bis zu einfachen Handlungsschritten. Pflege wird darin nach wie vor zu wenig mitgedacht, aber dennoch: Als Grundlagen-Ratgeber ist das Dokument hervorragend. Klar beschrieben, ohne Fachjargon, und so aufbereitet, dass man sie im Alltag sofort versteht. Sie ist auch als gedruckte Broschüre erhältlich, die man zu Hause griffbereit haben kann. Es gibt auch immer wieder Informationstage, ich war etwa bei einem Katastrophenschutz-Tag in Paderborn. Bei diesen Infotagen kann man sich bei den lokalen Hilfsorganisationen konkreten Tipps holen.
Diese Ratgeber und Informationen geben Sie in eine eigene Notfall-Mappe – das ist ganz banal, aber enorm hilfreich. Eine Mappe, in der alle wichtigen Unterlagen gesammelt sind: Dokumente, Kontakte, medizinische Informationen, Versicherungen, eventuell auch eine kleine Checkliste. Ich habe das in unseren Einrichtungen ebenfalls empfohlen. Wir haben ja intern ein Krisenteam, und dort gehört so etwas in die Standardausstattung.
Und dann gibt es noch etwas, das aus meiner Sicht unterschätzt wird: Regionale Anlaufstellen – bei manchen heißen sie so, anderswo `Leuchttürme´. Inhaltlich ist das oft dasselbe: Orte, an die man sich im Ereignisfall wenden kann und wo Informationen, Unterstützung oder Basisversorgung organisiert werden. Machen Sie sich mit ihrer Gemeinde vertraut: Wo ist mein nächster Anlaufpunkt – und wie erreiche ich ihn? Solche Infos bekommt man oft im Rathaus, im Bürgerzentrum oder über lokale Broschüren. Das ist sicher der konkreteste Einstieg für Menschen, die sich zum ersten Mal mit Vorsorge beschäftigen. Diese lokalen Ratgeber sind für die erste Orientierung im eigenen Umfeld ideal. Viele ältere Menschen brauchen hier aber Unterstützung oder wollen das nicht alleine organisieren.
Und ein weiterer Punkt, der mir dabei wichtig ist – gerade mit Blick auf die häusliche Versorgung: Auch ambulante Pflegedienste spielen hier eine zentrale Rolle. Sie sind im Alltag nah dran, kennen viele Situationen und können, wenn es entsprechende Absprachen gibt, bei Vorbereitung und Routinechecks unterstützen. Das ist im Krisenfall nicht die alleinige Lösung, aber ein Baustein, den man im häuslichen Bereich unbedingt mitdenken sollte.
Mein persönlicher Rat: Nutzen Sie solche Kontakte. Dokumente, Konzepte, Ratgeber – es gibt schon einiges. Aber tragfähig wird es oft erst, wenn man im Hintergrund auch Menschen und Organisationen kennt, die im Ernstfall erreichbar sind und nicht erst aufgebaut werden müssen.
<< Aber tragfähig wird es oft erst, wenn man im Hintergrund auch Menschen und Organisationen kennt, die im Ernstfall erreichbar sind.>>

Schwester Cornelia von der Kongregation der Franziskanerinnen Salzkotten (Nordrhein-Westfalen) verantwortet das Krisenmanagement ihrer Gemeinschaft – und bringt darüber hinaus Erfahrung aus bundesweiten Projektgruppen zur Krisenvorsorge ein.
Als Gründungsmitglied der BIVG, der deutschen Bundesinitiative für Vernetzte Gefahrenabwehr, kennt sie die Schnittstellen zwischen Versorgung, Behörden und Einsatzorganisationen aus nächster Nähe. Die Kongregation betreibt zwei stationäre Pflegeeinrichtungen, weiters werden Räumlichkeiten für einen angrenzenden Kindergarten zur Verfügung gestellt. (Fotocredit: Privat)
SBC: Sie waren in mehreren Projekten mit der Entwicklung von Krisenplänen beauftragt. Welche konkreten Vorbereitungen sind aus Ihrer Sicht für ältere Menschen – und für pflegende Angehörige – im Krisenfall wirklich sinnvoll, ohne zu überfordern?
Sr. Cornelia: Ich würde die Vorbereitung nicht überfrachten, sondern klar priorisieren. Aus meiner Sicht sind drei Punkte zentral:
Erstens: Kommunikation und Orientierung. Wenn Handy und Internet ausfallen, braucht es einen klaren Plan, wie man an verlässliche Informationen kommt, wenn die digitalen Kanäle wegbrechen: Ein batteriebetriebenes oder kurbelbares Radio ist die einfachste Variante. Ergänzend können Warn- und Notruf-Apps sinnvoll sein – als Baustein, nicht als alleinige Lösung. In Deutschland sind das etwa Warn-Apps wie NINA oder KATWARN, und für den Notruf die offizielle App Nora. Das ersetzt keine anderen Kanäle, kann aber helfen, sobald das Netz (auch nur zeitweise) wieder verfügbar ist.
Nach der ersten Orientierung folgen die praktischen Fragen: Was mache ich, wenn der Lift steht – und jemand Treppen kaum oder gar nicht mehr bewältigen kann? Solche Szenarien sollte man einmal nüchtern durchdenken, bevor sie eintreten. Und bei der Gelegenheit ein weiterer Hinweis: Wenn es einen Aufzug im Haus gibt, sehen sie bitte auch nach, ob jemand darin steckengeblieben ist.
Zweitens: Versorgung im Kleinen – ohne Perfektion. Haben sie Bargeld im Haus, weil Bankomaten und Kartenzahlung ausfallen können. Ein kleiner Bargeldbetrag zu Hause kann den Unterschied machen für kleine Einkäufe oder wenn ein Transport notwendig ist. Auch bei der Ernährung hilft Realismus mehr als Idealpläne: Wenn Kochen nicht möglich ist, braucht es Lebensmittel, die sich auch ohne Kochen nutzen lassen. Ein kleiner Vorrat, der zum Alltag passt, ist besser als perfekte Listen, die niemand umsetzt.
Besonders kritisch wird es, wenn es dunkel wird: Ältere Menschen verlieren schneller die Orientierung, die Sturzgefahr steigt. Treffen sie Maßnahmen gegen das Sturzrisiko, weil fehlendes Licht bei älteren Menschen schnell gefährlich wird. Lagern Sie daher griffbereit stromunabhängige Basic-Hilfsmittel wie Taschenlampen und Batterien. Wenn Pumpen ausfallen, wird Wasser nicht nur zum Trinken, sondern auch für Hygiene relevant – Stichwort Toilette. Auch hier helfen pragmatische Lösungen – inklusive Brauchwasser-Strategien und geeigneten Aufbereitungsmitteln.
Drittens – und das hat für mich die höchste Priorität: Medikamente. Weil so vieles digital organisiert ist und Nachversorgung im Ernstfall nicht verlässlich planbar ist, rate ich ganz klar zu Absprachen im Vorfeld mit der Lieferapotheke und – wenn möglich – auch mit der hausärztlichen Praxis. Nicht im Sinn von horten, sondern im Sinn von `wissen, was realistisch ist´: Welche Medikamente sind unverzichtbar? Wie kann eine kleine Reserve aussehen? Wie komme ich im Ernstfall überhaupt an das, was dringend gebraucht wird?
Ein Thema, das oft zu spät gesehen wird, ist die Kühlkette von Medikamenten. Insulin ist das bekannteste Beispiel, aber nicht das einzige. Da stellt sich ganz pragmatisch die Frage: Welche Kühlmöglichkeit habe ich überhaupt, wenn der Strom weg ist? Gibt es eine Notstromlösung für den Haushalt – notfalls auch gemeinsam angeschafft oder geteilt mit den NachbarInnen? Man muss nicht alles perfekt lösen, aber man sollte die Abhängigkeiten kennen.
Und zuletzt: Der wichtigste Puffer ist oft nicht Technik, sondern Beziehung. Im Notfall entscheidet ganz Alltägliches, ob jemand handlungsfähig bleibt. Wenn Angehörige da sind, ist es entscheidend, dass man Dinge vorher bespricht: Wie erreichen wir uns? Wer hat einen Schlüssel für die Wohnung und schaut nach, wie es den Großeltern geht?
Für Menschen mit Demenz oder in sehr eingeschränkter Mobilität gilt das umso mehr: Aus Unsicherheit kann schnell Unruhe oder Verwirrung werden. Hier wird eine Krise schnell zur Überforderung, wenn niemand vorbereitet ist. Genau hier wird Nachbarschaft zum Sicherheitsfaktor. Angehörige können enorm entlastet werden, wenn sie im Vorfeld Absprachen mit Nachbarinnen und Nachbarn treffen: Wer schaut im Zweifel vorbei? Wer reagiert, wenn niemand ans Telefon geht? Und welches einfache Zeichen gilt als `Bitte nachsehen´?
Stromausfälle passieren regional immer wieder – und ich sage das ganz bewusst ohne Alarmismus. Und dann wird es für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen sehr schnell unerquicklich. Deshalb gehört für mich zur Vorsorge auch eine Haltung: Wir haben eine Verantwortung füreinander. Nicht nur für die eigene Familie, sondern auch im direkten Umfeld. Im Ernstfall ist man froh, wenn jemand mitdenkt – und genauso kann man selbst für andere der Unterschied sein.
Mein Fazit ist deshalb: Krisenvorsorge muss nicht kompliziert sein – aber sie muss konkret und anschlussfähig an den Alltag sein. Und genau da helfen ehrliche Simulationen und klare Prioritäten mehr als jede perfekte Checkliste.
<< Krisenvorsorge muss nicht kompliziert sein – aber sie muss konkret und anschlussfähig an den Alltag sein.>>
SBC: Sie haben als Mitglied einer Projektgruppe der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege eine unterstützende Handreichung erstellt, mit der sich stationäre Pflegeeinrichtungen und Tagespflegeeinrichtungen besser auf Krisen und ihre Bewältigung vorbereiten können. Können Sie uns ein wenig über dieses Projekt erzählen?
Sr. Cornelia: Ich bin damals über die Caritas angesprochen worden. Wir waren rund 60 Personen in einer Arbeitsgruppe, später aufgeteilt in Untergruppen. Das Ergebnis wurde im Februar 2023 veröffentlicht und ist online abrufbar – inklusive Checklisten, Priorisierungshilfen, Notfallplänen und Empfehlungen zur Bevorratung. Später wurde dieses Vorgehen auch auf ambulante Pflegedienste übertragen, denn auch dort müssen inzwischen Krisenkonzepte vorliegen. In diese zweite Handreichung war ich nicht mehr eingebunden, aber auch die ist sehr empfehlenswert, weil sie konkrete Materialien liefert.
Was bei all diesen Projekte ganz klar herauskommt ist die Wichtigkeit von Vernetzung. Ein Konzept ist nur dann belastbar, wenn vorher geklärt ist, wer im Ernstfall mit wem kooperiert. Wir haben zum Beispiel bewusst Kooperationen vorbereitet – etwa für den Fall, dass wir evakuieren müssen und kurzfristig Plätze in einer anderen Einrichtung oder sogar im Krankenhaus brauchen. Und genauso wichtig ist die interne Vernetzung mit Lieferanten, Technikfirmen, Dienstleistern – alle, die im Krisenfall entscheidend sein können, damit die Versorgung nicht komplett abreißt. Denn eines ist gesetzlich klar: Pflegeeinrichtungen müssen auch in Krisen die Grundversorgung der Bewohnerinnen und Bewohner aufrechterhalten können. Das ist nicht optional. Und das gilt im Übrigen nicht nur für Pflegeheime, sondern genauso für Krankenhäuser und für Apotheken.
Gerade Apotheken sind ein gutes Beispiel dafür, wie verletzlich unsere Systeme sind. Wir hatten zwar keinen Blackout, aber wir haben eine Situation erlebt, in der durch ein problematisches Software-Update plötzlich vieles nicht mehr lief: Bestellsysteme, Ausgabesysteme, die gesamte digitale Logistik. Eine Apotheke in der Nähe war betroffen, es ging schlicht nichts mehr. Da sieht man: Es braucht nicht immer das große Katastrophenszenario. Ein digitaler Ausfall kann ähnliche Folgen haben – und zwar sofort.
Angehörigen im häuslichen Umfeld empfehle ich: Sprechen Sie mit der Lieferapotheke, solange alles normal läuft. Klären Sie: Was passiert, wenn Strom, IT oder Logistik ausfallen? Was ist realistisch – und was nicht? Natürlich gibt es Verträge und Zusagen, aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Umso wichtiger ist, dass man diese Schnittstellen kennt, die Kommunikation aufbaut und nicht erst im Ernstfall versucht, jemanden zu erreichen.
Kurz gesagt: Gute Krisenvorsorge besteht nicht aus Papier. Sie besteht aus praxistauglichen Plänen, klaren Prioritäten – und verlässlichen Beziehungen zu den Stellen, die dann wirklich gebraucht werden.
<< Kurz gesagt: Gute Krisenvorsorge besteht nicht aus Papier. Sie besteht aus praxistauglichen Plänen, klaren Prioritäten – und verlässlichen Beziehungen zu den Stellen, die dann wirklich gebraucht werden.>>
Auch eine der wichtigsten Erkenntnisse: Pläne wirken erst dann wirklich, wenn man sie testet. Nicht theoretisch, sondern ehrlich – mit realistischen Annahmen. Und ja, das ist Aufwand: Kommunikation mit Stadt und Einsatzorganisationen, interne Abstimmungen, Vorbereitung. Aber genau dadurch sieht man, wo man nachrüsten muss. Es ist wie bei einer Feuerwehrübung: Erst im Tun merkt man, was fehlt.
SBC: Gibt es Punkte im Krisenmanagement oder in der Vorsorge, wo sie noch Entwicklungspotential sehen?
Sr. Cornelia: Innerhalb Deutschlands ist die Krisenvorbereitung und das Management je nach Bundesland teilweise unterschiedlich aufgebaut. Hessen tickt anders als Nordrhein-Westfalen – und genau diese Uneinheitlichkeit macht es in der Praxis manchmal wirklich mühsam. Das haben wir in der Pandemie ja schon sehr deutlich erlebt.
Und dann sind wir bei einem Thema, das mich ehrlich gesagt seit Jahren ärgert: Die Frage der kritischen Infrastruktur. Krankenhäuser, Feuerwehr und klassische Einsatzorganisationen gelten als kritische Infrastruktur und haben dadurch oft auch bessere Zugänge zu Ressourcen. Stationäre Pflegeeinrichtungen hingegen fallen vielerorts nicht automatisch darunter. Und das ist aus meiner Sicht schwer nachvollziehbar, weil dort Menschen leben, die im Krisenfall nicht einfach mal schnell selbstständig reagieren können.
Ich spreche das auch regelmäßig an, unter anderem gegenüber Stellen, die in Deutschland mit Bevölkerungsschutz zu tun haben. Ich kämpfe seit Monaten dafür, dass stationäre Pflegeeinrichtungen in der Logik der kritischen Infrastruktur endlich ernsthaft mitgedacht werden. Solange das nicht passiert, hängen Förderungen und Investitionen oft an Zufällen: Wer zahlt’s? Wer fühlt sich zuständig? Und am Ende heißt es dann gern: Die Einrichtung ist selbst verantwortlich.
Wir haben eine Förderung von Nordrhein-Westfalen zur Weiterentwicklung unserer Krisenvorbereitung genutzt: Im Dezember 2022 gab es einen Erlass seitens des Ministeriums (MAGS), bei dem stationäre Pflegeeinrichtungen Notstromaggregate refinanziert bekommen konnten. Zunächst bis 25.000 Euro, später wurde der Rahmen sogar auf 50.000 Euro erhöht, weil der Topf nicht ausgeschöpft wurde. Wir haben das für unsere beiden Häuser genutzt, weil es schlicht logisch ist: Ja, da hängen Auflagen dran – Wartung, Nachweise, regelmäßige Checks. Aber das nimmt man doch in Kauf, wenn man damit Versorgungssicherheit schafft.
Was mich bis heute fassungslos macht: Dass so wenige Einrichtungen dieses Angebot überhaupt wahrgenommen haben. Und gleichzeitig verlassen sich viele darauf, dass im Ernstfall `eh jemand kommt´ – Feuerwehr, Katastrophenschutz, Kommune. Nur: Genau das ist eben nicht garantiert.
Bei uns kommt noch dazu: Wir haben an einem Standort nicht nur die Pflegeeinrichtung, sondern auch unser Mutterhaus und den Kindergarten, dem wir die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Wenn da Stromausfall ist, reden wir nicht nur über Komfort, sondern über Verantwortung – und zwar unabhängig davon, ob der Gesetzgeber uns in die Schublade „KRITIS“ steckt oder nicht.
Vielen Dank für das Interview!
Hier geht’s zur Homepage der Kongregation der Franziskanerinnen Salzkotten https://fcjm.de
Author: Anja Herberth
Chefredakteurin