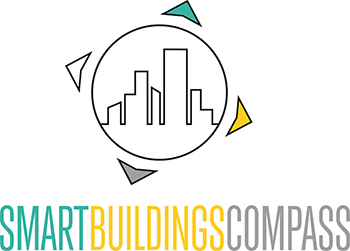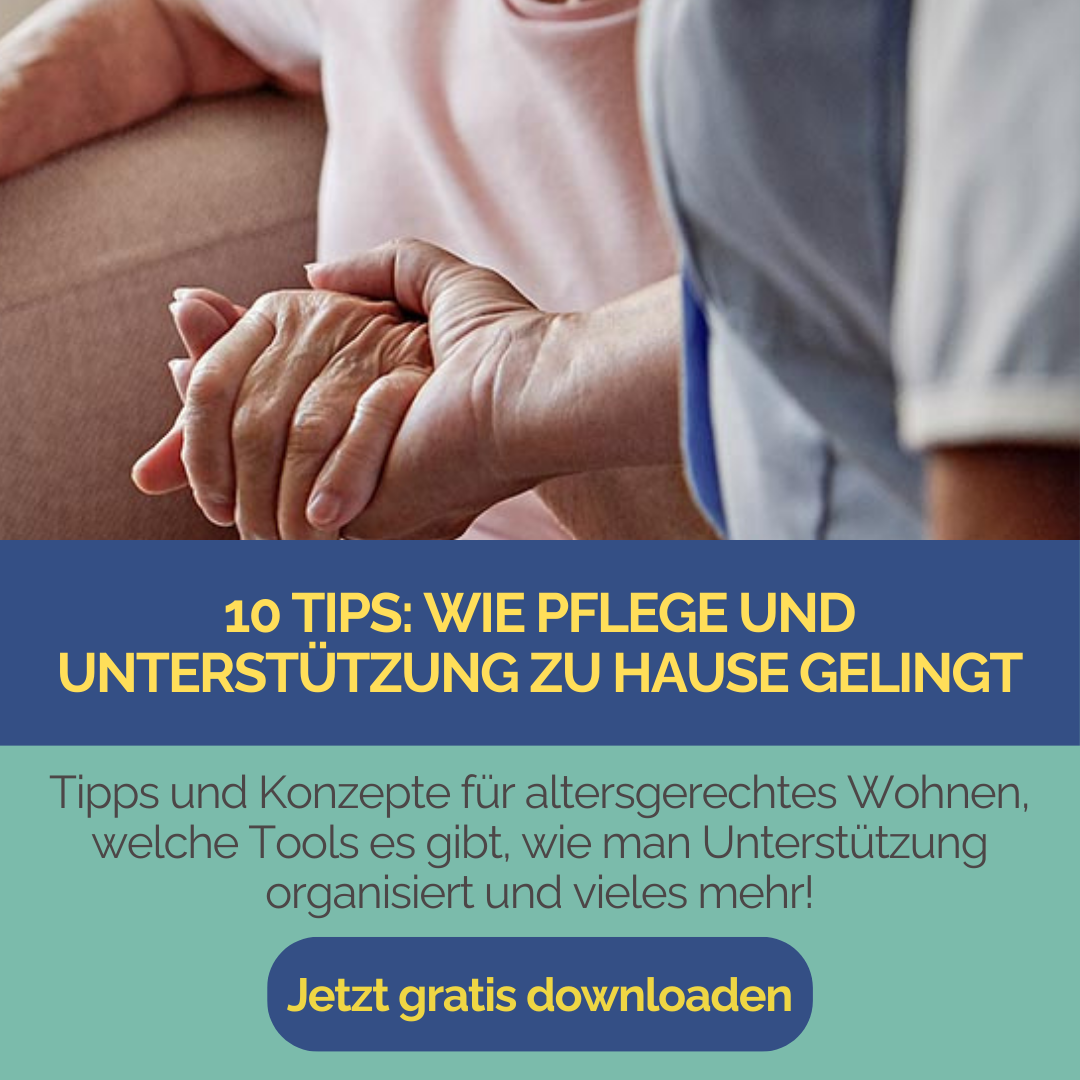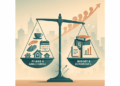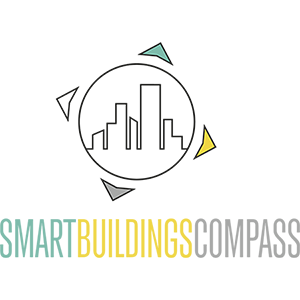In Zeiten des demografischen Wandels stehen die Städte vor der großen Herausforderung, sich auf die Bedürfnisse älterer und demenzkranker Menschen einzustellen. Mit ihrem Projekt „Dementievriendelijk Brugge“ zeigt die Stadt Brugge im Nordwesten Belgiens (Westflandern), wie eine lebenswerte, integrative Stadt aussehen kann.
Auch Brugge steht vor den Herausforderungen einer alternden Bevölkerung. Die Stadt hat sich daher für eine aktive Gesundheits- und Sozialpolitik entschieden. Projektleiterin Quintina Jonckheere ist eine der treibenden Kräfte hinter dem Konzept der „demenzfreundlichen Stadt“ – und betont: „Man muss nicht perfekt vorbereitet sein – man muss nur loslegen“.
Was bedeutet „demenzfreundliche Stadt“?
Brugge verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für das Thema Demenz. Es geht nicht nur um Pflege und medizinische Behandlung. Das Thema wird aus der Tabuzone geholt, und Menschen mit Demenz werden aktiv in die Stadt und in das gesellschaftliche Leben einbezogen. Im Mittelpunkt stehen die Lebensqualität und die Möglichkeiten der Betroffenen – nicht nur ihre Diagnose und ihre Defizite: „Wir schaffen Sichtbarkeit, ohne zu stigmatisieren.“

Diese Haltung spiegelt sich in den vom Projektteam formulierten Grundprinzipien wider (siehe Infokasten unten). Sie reichen von der respektvollen Kommunikation über die gesellschaftliche Teilhabe bis hin zur Unterstützung der pflegenden Angehörigen. Letztlich geht es darum, ein Stadtklima zu schaffen, in dem Menschen mit Demenz sichtbar, willkommen und einbezogen sind.
Zwei Beispiele veranschaulichen den Ansatz: Informationen sollten klar und respektvoll formuliert werden, und Gespräche sollten die Menschen immer persönlich ansprechen. Das Personal in der Gastronomie wird zum Beispiel darin geschult, wie es Menschen mit Demenz besser unterstützen kann. Zum Beispiel durch eine klare Sprache, ausreichend Zeit zum Bezahlen oder das Wiederholen von Informationen. „Schon kleine Dinge machen einen großen Unterschied für die Betroffenen“, sagt Jonckheere. Auch Museen bieten Führungen für Menschen mit Demenz an. Speziell geschulte Museumsführer ermöglichen Menschen mit Demenz einen ruhigen und ungestörten Rundgang durch ausgewählte Kunstwerke.
Gemeinsam statt einsam
Das Herzstück des Projekts ist das Lernnetzwerk, in dem sich zahlreiche lokale Organisationen regelmäßig austauschen: Pflegeheime, Sozialdienste, Bildungseinrichtungen und Freiwillige arbeiten gemeinsam an Ideen, wie Brugge demenzfreundlicher werden kann. Dabei gibt es auch Bereiche, die auf den ersten Blick nichts mit Pflege zu tun haben: Zum Beispiel die Sportverwaltung, kulturelle Einrichtungen, das Bauamt, der Bürgerservice. Überall treffen Menschen mit Demenz auf Mitarbeiter, die geschult und sensibilisiert werden sollten.
„Auch in Bereichen, in denen man es nicht erwartet, muss das Thema präsent sein“, betont Jonckheere. Nur durch kontinuierliche Aufklärungsarbeit könne Demenz als Gemeinschaftsaufgabe in der Stadtgesellschaft verankert werden: „Die Zusammenarbeit ist entscheidend. Keiner kann das Thema alleine angehen – wir brauchen die ganze Stadt.“ Die große Zahl der beteiligten Organisationen zeigt, wie sehr eine alternde Gesellschaft das städtische Leben beeinflusst und sich auf alle Lebensbereiche auswirkt.
Auch pflegende Angehörige sind Teil des Netzwerks. Ihre Rolle ist entscheidend, betont Jonckheere: „In Zukunft wird die Gesellschaft noch stärker auf die Pflege von Angehörigen angewiesen sein. Deshalb müssen wir alles tun, um diese Menschen zu unterstützen.“ Viele pflegende Angehörige stehen ohnehin schon unter großem Druck: Arbeit, Kinder, Haushalt – und dann noch die Pflege eines Demenzkranken. „Es wird massiv unterschätzt, wie belastend das sein kann“, sagt Jonckheere.
Um die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft zu meistern, werden gemeinsam Ideen diskutiert, Ergebnisse analysiert und Lehren aus den Erfahrungen gezogen. Dabei geht es nicht um ein festes Maßnahmenpaket, sondern um einen kontinuierlichen Dialog: „Unsere Arbeit ist nie abgeschlossen“, sagt Jonckheere. Vielmehr handelt es sich um einen fortlaufenden Prozess, in dem politische Signale gesetzt, Erfahrungen ausgetauscht und gemeinsam konkrete Verbesserungsvorschläge erarbeitet werden.
Quintina Jonckheere erläutert einen weiteren Vorteil der Zusammenarbeit: Obwohl es viele gute Lösungen für Menschen mit Demenz gibt, sind diese oft nicht bekannt – weder bei den Betroffenen noch bei den Organisationen selbst. Kooperation ist daher unerlässlich: „Wenn wir zusammenarbeiten, profitieren alle davon. Die Organisationen, aber vor allem die Menschen mit Demenz, die nicht von einem Ort zum nächsten geschickt werden müssen.“
Wer bei der Stadt eine Förderung für ein demenzfreundliches Projekt beantragt, muss auch mit anderen Akteuren vor Ort kooperieren – das ist eine klare Voraussetzung. Denn nur gemeinsam können synergetische Lösungen entwickelt werden, die über den individuellen Ansatz hinausgehen und die Stadt als Ganzes demenzfreundlicher machen.

Neue Ansätze in der Pflege und Betreuung
Quintina Jonckheere betont, dass die Alterung der Bevölkerung und damit verbundene chronische Erkrankungen wie Demenz eine dauerhafte Herausforderung für die Gesellschaft sein werden. Deshalb wird ein grundlegender Wandel im Denken im Gesundheitswesen immer wichtiger: Weg von einem rein medizinischen Ansatz („Heilung“) hin zu einem fürsorglichen, personenzentrierten Ansatz („Pflege“).
Diesen neuen Ansatz – auch bekannt als „cure to care“ – verfolgen immer mehr Organisationen und Bildungseinrichtungen, wie zum Beispiel die Hochschule HoWest“ in Brugge, verfolgen diesen Ansatz. Sie haben sogar ein eigenes Schulungspaket mit dem Titel „Van Cure naar Care“ – also „Von der Heilung zur Pflege“ – entwickelt. Ihr Ziel: Erhöhung der Palliativpflegekompetenzen von Gesundheitsdienstleistern und Verbesserung der Integration von möglicher Pflegeplanung, Palliativpflege und Pflege am Lebensende in flämischen Gesundheitsorganisationen.
Gleichzeitig wird die Pflege zunehmend zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe: Nachbarschaften, Freiwillige und Vereine spielen eine immer wichtigere Rolle. Gute Pflege darf nicht allein auf den Schultern von Einzelpersonen ruhen: „Wir brauchen ‚fürsorgliche Nachbarschaften‘.“
In Brugge wird dieses Konzept durch spezifische Projekte gefördert, die die Nachbarschaftshilfe stärken und die gegenseitige Unterstützung im Alltag erleichtern. Die Daten zeigen, dass vor allem Menschen mit niedrigem sozioökonomischem Status oft stärker von ihrer Nachbarschaft abhängig sind als von Familie oder Freunden. „Wenn wir die am meisten gefährdeten Menschen in unserer Stadt schützen wollen, müssen wir ihre Nachbarschaft stärken“, erklärt Jonckheere. Solche Nachbarschaftsstrukturen machen die Stadt nicht nur demenzfreundlicher, sondern fördern auch die soziale Teilhabe.
Blick nach vorn: Was die Zukunft bringt
Was wünscht sich Quintina Jonckheere für die Zukunft? Dass sich die Stadt zu einer gesunden Stadt mit Bürgern entwickelt, die über ein hohes Maß an Gesundheitskompetenz verfügen. Das bedeutet, dass die Menschen in der Lage sind, Gesundheitsinformationen zu verstehen, kritisch einzuordnen und sie auf ihre eigene Lebenssituation anzuwenden. Umfragen zeigen derzeit, dass die Gesundheitskompetenz vieler Bürgerinnen und Bürger in Belgien noch zu gering ist: „Fast zwei Drittel der Belgier verfügen über unzureichende Gesundheitskompetenzen.“ Ein Handlungsfeld, dem Jonckheere besondere Aufmerksamkeit widmen wird.
Welchen Rat hat Jonckheere für andere Städte? „Warten Sie nicht. Fangen Sie einfach an. Auch kleine Schritte können eine große Wirkung haben.“ Sie betont, dass der Aufbau einer demenzfreundlichen oder fürsorglichen Gemeinschaft nicht von perfekten Bedingungen oder großen Budgets abhängt. Der erste Schritt besteht darin, Gespräche zu beginnen, lokale Experten einzubeziehen, zuzuhören und vorhandene Ressourcen zu vernetzen. Auf diese Weise können Lösungen, die oft schon vor Ort vorhanden sind, sichtbar und wirksam werden.
Weitere Informationen über das Projekt:
🔗 www.brugge.be/dementievriendelijk
Was macht Brugge demenzfreundlich?
Die Stadt konzentriert sich auf einen ganzheitlichen Ansatz, der über Pflege und Medizin hinausgeht:
- Tabubrechende Maßnahmen schärfen das öffentliche Bewusstsein für Demenz. Herausforderungen können nur bewältigt werden, wenn wir darüber sprechen.
- Der Fokus liegt auf den Stärken und Möglichkeiten der Betroffenen – ohne deren Einschränkungen zu leugnen. Lebensqualität auch mit einer Demenzdiagnose.
- Menschen mit Demenz erhalten eine Stimme und werden aktiv in Projekte eingebunden.
- Demenzfreundliche Kommunikation ist entscheidend – einfach, respektvoll und inklusiv.
- Die Zusammenarbeit zwischen einer Vielzahl von Organisationen schafft ein Netz gemeinsamer Verantwortung.
- Pflegende Angehörige werden einbezogen und wertgeschätzt.
- Nachbarschaften werden gestärkt, um gemeinsam zu helfen.
- Mit Sensibilisierungskampagnen wird das Verständnis in der Gesellschaft gefördert.
Author: Anja Herberth
Chefredakteurin