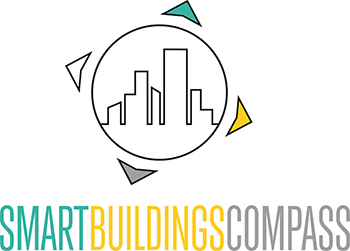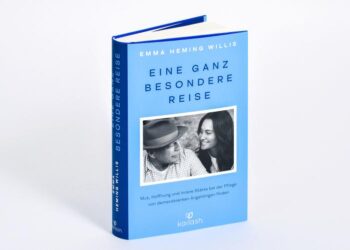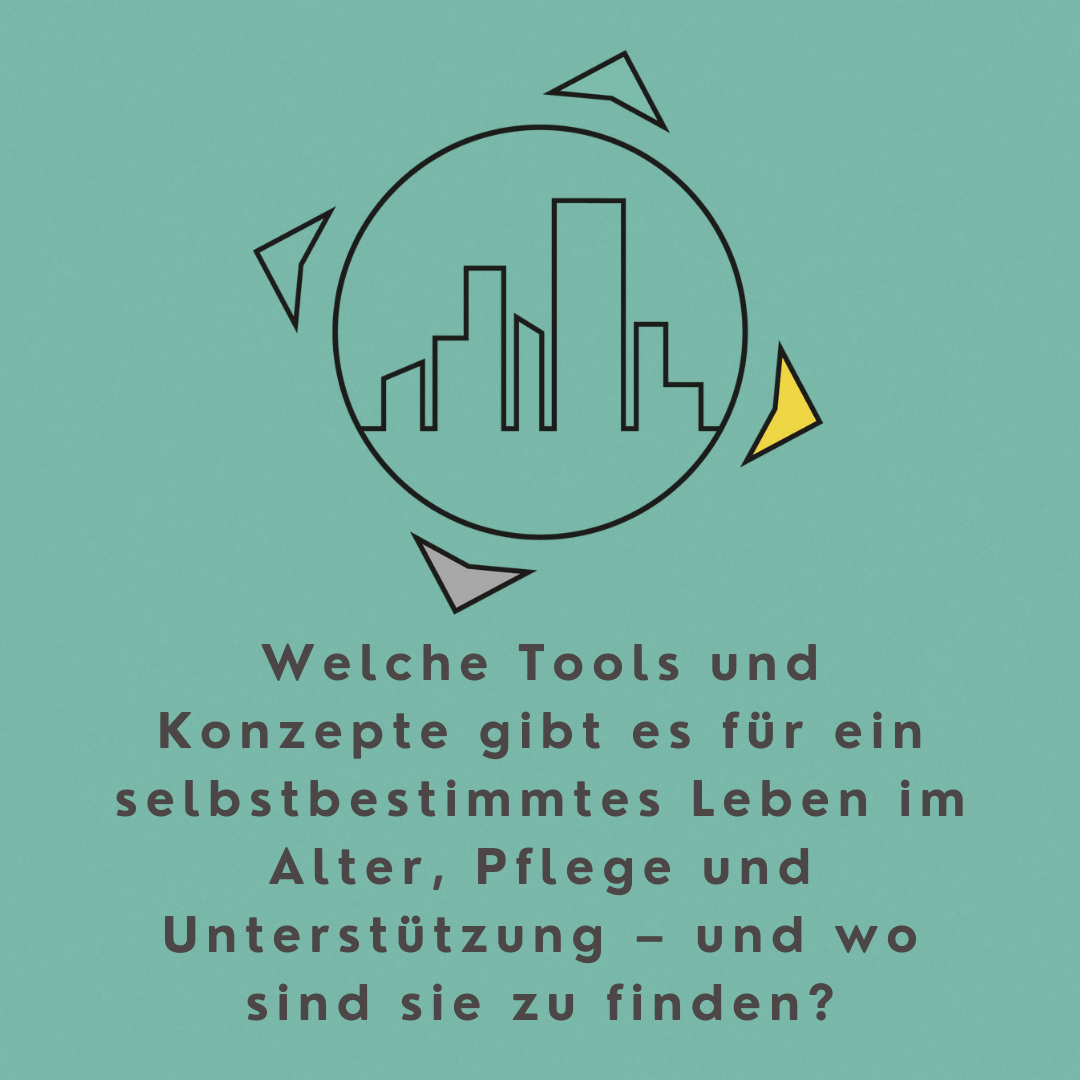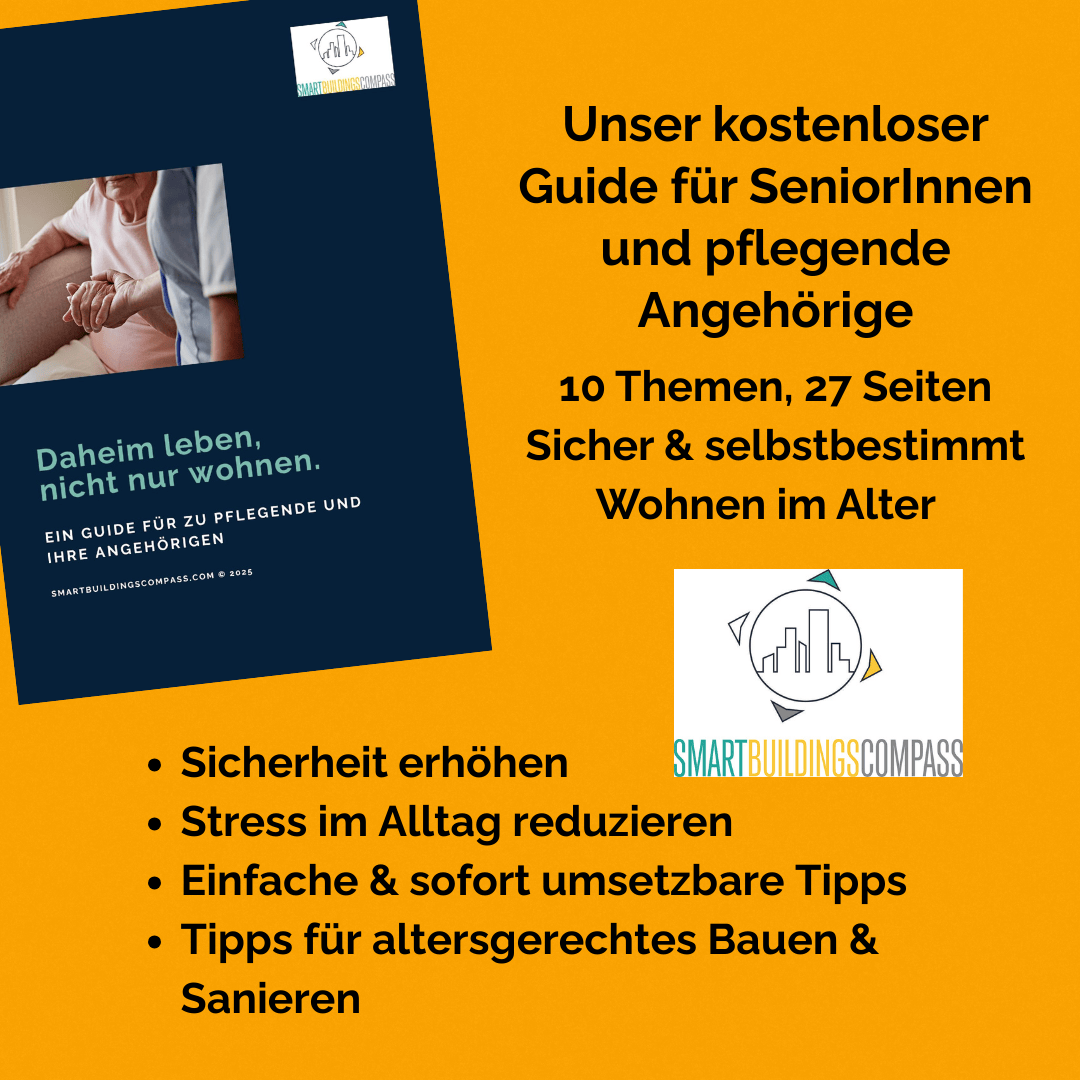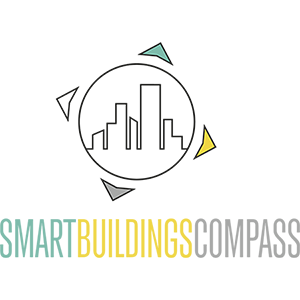This article is also available in:
English
Demenz ist mehr als eine Diagnose – sie betrifft Sprache, Rollen, Räume und Haltung. Die Initiative & Kompetenzplattform PROMENZ zeigt auf, wie Selbsthilfe, ein respektvoller Umgang und niederschwellige Angebote Barrieren abbauen und Teilhabe ermöglichen. Wir sprechen mit Geschäftsführer Raphael Schönborn, warum der Defizitblick zu kurz greift, wie das selbst entwickelte Verständnis-Modell in der Praxis funktioniert und weshalb frühe Abklärung und offene Gespräche Betroffenen wie Angehörigen spürbar helfen.
SBC: PROMENZ ist aus der Selbsthilfe entstanden – ein bewusst aktiver Ansatz. Was bedeutet „aus der Betroffenenperspektive arbeiten“ bei Ihnen konkret, und wie zeigt sich das in ihren Angeboten?
Schönborn: Es geht uns darum, dass Betroffene für sich selbst auch noch aktiv sein können. Es ist ein wichtiger Aspekt für die Gesundheitsförderung, dass wir diese Selbsthilfe verankern, stärken und fördern.
Menschen mit Demenz tun sich schwer, sich selbst zu organisieren und sie treten auf Grund des Tabus und Stigmas auch viel zu wenig in die Öffentlichkeit, werden viel zu wenig sichtbar und gehört. Daher ist es notwendig, dafür Unterstützung bereitzustellen und Räume zu organisieren. Es geht uns vor allem darum, offen reden zu können. Das können wenige – aber diese wenigen können dann wiederum für die Vielen sprechen und auch ihnen helfen, dieses Stigma, dieses Tabu abzubauen.

SBC: Aktuell feiert das Verständnis-Modell, das ihr Verein entwickelt hat, den ersten Geburtstag. Wie funktioniert dieses Modell?
Schönborn: Zum Thema Demenz gibt es einige Modelle, die hauptsächlich aus der Medizin stammen und die einen sehr stark defizitorientierten Blick verfolgen. Demenz ist ein Abbau, ein sukzessives Verlieren von Fähigkeiten, Eigenschaften und Fertigkeiten. Und der Schrecken wird dadurch immer fortgeschrieben. Es geht uns nicht darum, das zu negieren. Natürlich stimmt das – Demenz ist schrecklich. Aber wir merken, dass wir damit nicht weiterkommen, wenn es darum geht, die Betroffenen zu erreichen. Oder es wird dieses einseitig negative Bild kommuniziert, wodurch sich wenige Bewältigungsstrategien, aber soziale und strukturelle Barrieren aufbauen.
Wir haben daher mit den Betroffenen ein Modell entwickelt, indem wir im Rahmen von qualitativer Forschung, durch Interviews und Durchsicht vieler Protokolle herausgefiltert haben: Wo liegen die Beeinträchtigungen bei Menschen mit Demenz? Also wie benennen sie selbst ihre Beeinträchtigungen? Wie nehmen sie sie wahr? Welche Ebenen lassen sich kennen – geistige Beeinträchtigungen, Gedächtnisorientierung, natürlich auch Sprache. Auf der körperlichen Ebene äußern sie oftmals Schwindel oder die Einschränkung von Selbstständigkeit.
Und dann ist da noch der emotionale Bereich, der ist besonders ausgeprägt. Da merkt man einfach, dass Demenz zu einer massiven Verunsicherung und Irritation führt, dass man das Gefühl der Minderwertigkeit verspürt. Und dann gibt es auch den sozialen Bereich. Diese Ebenen sind miteinander verbunden. Betroffene merken, dass man sie anders behandelt, sobald bekannt wird, dass sie eine Demenz haben. Das führt dazu, dass man sie nicht mehr als vollwertig betrachtet. Man spricht von Menschen mit Demenz, als wären sie in einer anderen Welt. Und das ist hochgradig problematisch, weil dieses Andersmachen führt zu einer Andersbehandlung. Es liefert auch die Erklärung dafür, warum so viele Betroffene nicht darüber sprechen können.
Demenz ist der Inbegriff für Andersartigkeit, für nicht mehr normal, nicht mehr dazuzugehören. Sie ist quasi auch der Verlust von Würde, von Status, von Anerkennung. Die Diagnose ist für die Betroffenen wie der soziale Tod.
SBC: Wie verankern Sie die Innenperspektive von Betroffenen methodisch in Ihrem Modell – und wie wird daraus ganz konkret Barrieren-Abbau im Alltag?
Schönborn: Das Modell erweitert das Verständnis von einem rein defizitorientierten, hin zu einem sozialen und strukturellen Modell. Es ist angelehnt an ein menschenrechtliches Modell, in dem Menschen nicht nur beeinträchtigt sind, sie werden auch behindert oder beeinträchtigt. Und letztlich geht es darum, diese Barrieren zu identifizieren und aus der Innenperspektive zu verstehen. Nur dann können wir diese Barrieren abbauen.
Und da wird klar, dass Betroffene die gleichen Bedürfnisse haben wie wir gesunde Menschen. Wenn wir fragen: Was wünscht ihr euch, was braucht ihr? Dann geben sie ganz klar Auskunft, dass sie sich wünschen, als vollwertig angesehen und behandelt zu werden. Dass man ihnen immer noch Selbstständigkeit und Autonomie, Selbstbestimmung und Teilhabe zutraut. Dass man ehrlich und aufrichtig mit ihnen spricht. Alles Aspekte, die sich vermutlich jeder andere Mensch auch wünscht.
Und aufbauend auf diesen Erkenntnissen haben wir Handlungsempfehlungen für verschiedene Berufsgruppen formuliert bzw. für verschiedene AdressatInnen.
SBC: Welche Handlungsempfehlungen wären das beispielsweise?
Schönborn: Versucht, euch zu öffnen. Versucht, euch Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Redet offen darüber. Besucht Selbsthilfe–Gruppen, auch für Angehörige. Dass man nicht immer nur die Defizite sehen soll, sondern andere Ressourcen und Stärken. Dass die Betroffenen nichts dafür können und ständiges Berichtigen und Korrigieren auch dazu führt, dass die Betroffenen immer im Selbstwert massiv verletzt werden. Und natürlich haben wir auch Handlungsempfehlungen für Entscheidungsträgerinnen und für Bildungseinrichtungen.
Wir haben unser Modell in eine Broschüre überführt, die einfach und leicht verständlich ist. Sie ist auf unserer Homepage downloadbar.

SBC: Ist dieser skizzierte negative Umgang mit Erkrankungen wie Demenz auch einer der Gründe, warum wir Diagnosen gerne vermeiden?
Schönborn: Grundsätzlich ist das Holen von Diagnosen wahnsinnig schwierig und es bedeutet auch Überwindung. Ein weiterer psychodynamischer Grund bei der Demenz ist die Ablehnung aufgrund dieses Schreckens. Wenn man sich vorstellt, wie schrecklich und furchtbar eine Demenz ist, dass man den Verstand verliert und nichts dagegen machen kann. Und wenn man die Krankheit offen kommuniziert, wird man auch noch benachteiligt. Also warum soll man sich das abholen?
Es liefert auch eine Erklärung dafür, warum so viele Betroffene nicht darüber sprechen können. Die Frage ist ja immer: Können sie nicht darüber sprechen, wollen sie nicht darüber sprechen oder haben sie auch gar keine Einsicht? Es ist eine weit verbreitete Meinung, dass Menschen mit Demenz es nicht erkennen würden. Und das halte ich für Schwachsinn, besonders im frühen Verlauf.
Die meisten Betroffenen schaffen es nicht, das in ihr Selbst, in ihre Persönlichkeit zu integrieren. Deswegen kommt es zur Abwehr, zur Negierung. Die anderen sind schuld, die anderen haben etwas gestohlen oder verlegt. Man schützt sich selbst vor dieser Zuschreibung. Dieses Verständnis ist aber für den Umgang essentiell. Nur wenn wir Demenz aus der Perspektive der Betroffenen nachvollziehen und verstehen, können wir adäquat mit ihnen umgehen und ganz viele Konflikte vorbeugen.
SBC: Welche ersten Schritte raten Sie daher Betroffenen und pflegenden Angehörigen?
Schönborn: Der wichtigste Tipp für pflegende Angehörige oder für die Betroffenen: Sich rasch eine Diagnose und Hilfe holen, wenn man merkt, es hat sich etwas verändert. Eine frühe Abklärung ist entscheidend, denn es gibt nicht die eine Demenz, sondern verschiedene Formen. Manche Ursachen sind behandelbar, wenn sie rechtzeitig erkannt werden.
Auch wenn Medikamente keine Wunder bewirken, den Verlauf nicht stoppen oder umkehren können, so können sie den Verlauf positiv beeinflussen. Aber nur sofern klar ist, um welche Form es sich handelt. Es gibt neue Wirkstoffe bei frühen Alzheimer-Formen, sie sind aber nur für eng definierte Personengruppen zugelassen und erfordern eine umfassende Vorab-Abklärung sowie ein enges Monitoring. Studien berichten von einem verzögerten Fortschritt von bis zu einem Drittel, was für Betroffene sehr relevant sein kann. Das macht Hoffnung, weil diese Behandlungswege vielleicht in Zukunft schon früher ansetzen können und dadurch die Schädigung im Gehirn gar nicht erst entstehen muss.
Es ist daher sehr wichtig, dass eine Diagnose eingeholt wird. Verdrängen hilft nicht – die Probleme werden dadurch meist größer, für die Betroffenen und die Angehörigen. Offene Gespräche und frühzeitige Unterstützung sind deshalb der bessere Weg.
Niederschwellige Anlaufstellen wie Selbsthilfegruppen oder Beratungsstellen bieten hier Orientierung und zeitnahe Hilfe, ohne sofort einen Arzttermin oder die Neurologie zu benötigen. Wenn jemand von Promenz Unterstützung möchte, dann kommt man sofort in eine Gruppe oder wir machen zeitnah einen Termin aus. Wir wissen, wo es welche Unterstützung und Hilfe gibt und wir wissen auch, wie kommuniziert werden sollte, damit ehestmöglich Unterstützung in Anspruch genommen wird.
Wir können die Angst nicht nehmen oder die Situation schönreden – Demenz ist was Schreckliches. Aber man kann den Schrecken durch Unterstützung und Begleitung verringern und mit der Situation besser umgehen.
„Ich glaube, wir müssen Demenz immer mehr zu einer gestaltbaren und auch beeinflussbaren Beeinträchtigung machen. Dann kann man ihr auch den Schrecken nehmen.“

SBC: Was wünschen Sie sich von der Gesellschaft im Umgang mit Demenz?
Schönborn: Den älteren Menschen geht es historisch betrachtet so gut wie nie zuvor – was die Lebenserwartung, die gesundheitliche Versorgung und die Betreuung betrifft. Derzeit merken wir jedoch wieder Verschlechterungen, was insbesondere die Betreuung und Pflege betrifft. Die zu erwartenden Kürzungen in Österreich werden diesen Prozess noch beschleunigen. Dadurch erhält Prävention einen immer wichtigeren Stellenwert.
Es braucht dafür aber eine andere Botschaft. Das vorherrschende Narrativ lautet: Bei Demenz kann man nichts machen. Und das stimmt einfach nicht. Laut einer Studie, die von der Lancet-Kommission herausgegeben wurde, kann Demenz vorgebeugt werden. Es geht um die Kontrolle von 14 Risikofaktoren wie Rauchen, Bewegung, Gefäßgesundheit, aber auch mentale Gesundheit, Depressionen, Einsamkeit. Und natürlich spielt die Genetik eine Rolle, Bildung, aktiv zu sein, genug zu schlafen, Es gibt viele Aspekte, in denen man selbst aktiv etwas zur Prävention machen kann.
Die Medienanalysen, die es zur Demenz gibt, sind fatal. Verkürzt beschreiben sie, dass Demenz die Betroffenen und Angehörigen, und auf Grund der Kosten unser Sozial- und Wirtschaftssystem zerstört. Demenz wurde in unserer Gesellschaft zu einem Schimpfwort. Es ist auch nicht hilfreich, wenn ein Politiker einem anderen in einer Rede ausrichtet, er sei der jüngste Demenzpatient. Zieht man das zusammen, dann bleibt eine Botschaft über: Du bist nicht mehr zurechnungsfähig.
Ich glaube, wir müssen Demenz immer mehr zu einer gestaltbaren und auch beeinflussbaren Beeinträchtigung machen. Dann kann man ihr auch den Schrecken nehmen. Da geht es um Information, aber auch um Angebote: Wenn man nur informiert, wir können vorbeugen – und dann gibt es keine Angebote, dann stimmt die Botschaft nicht. Um etwas machen zu können, brauchen wir auch die entsprechenden Angebote. Und die gibt es kaum oder sie werden einfach nicht nachhaltig finanziert.
Es gibt natürlich auch positive Beispiele, wie zum Beispiel in Vorarlberg. Hier gibt es die Aktion Demenz, und ihre Bewusstseins- und Sensibilisierungsarbeit trägt Früchte. So gibt es etwa Demenz-Cafés, die den Menschen Möglichkeiten eröffnet, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Es braucht im Nahraum genau diese Aktivitäten, die auf das Thema aufmerksam machen, kommunizieren und auch Angebote setzen. Es bringt nichts, nur einfach zu informieren und dann gibt es keine regionalen, niederschwelligen Angebote. Das muss ineinandergreifen.
Was die Betreuung betrifft, müssen wir wirklich aufpassen, dass wir uns nicht in eine sehr negative Entwicklung gerade begeben.
SBC: Was würden Sie sich denn von der Politik wünschen?
Schönborn: Ich bin der Auffassung, dass das, was Betroffene und Angehörige brauchen, keine Raketenwissenschaft ist. Man müsste ihnen eigentlich nur zuhören, was wir oft genug getan haben. Es gibt genügend Belege für erfolgreiche, vielversprechende Initiativen, Projekte, Leistungen, Angebote. Das ist alles kein Geheimnis.
Was leider immer wieder passiert ist, dass auch gut evaluierte, evidenzbasierte Leistungen entweder nur für eine Projektlaufzeit finanziert werden oder auch schon bestehende Initiativen wieder eingestellt werden. Und das ist einfach verantwortungslos und kurzsichtig. Insgesamt ist es so, dass wir natürlich schon viel früher in Gesundheitsförderung und Prävention investieren müssten. Aktuell ist es um die finanzielle Ausgestaltung der Selbsthilfe in Österreich sehr schlecht gestellt. Wir würden gerne österreichweit Selbsthilfegruppen ausbauen, aber es scheitert immer an den Kosten und an der Nachhaltigkeit.
Weiters ist unser Gesundheits- und Sozialsystem sehr stark fragmentiert. Da und dort gibt es etwas Gutes, woanders ist die Leistung wieder weniger gut, da sind die Kosten höher, in einem anderen Bundesland sind sie wieder geringer. Diese Fragmentierung des Systems können wir uns eigentlich nicht leisten und es ist auch hochgradig unseriös.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
Zum Verein PROMENZ
Die Initiative wurde vor zehn Jahren auf Initiative der ehemaligen Obfrau Reingard Lange als erste Selbsthilfegruppe für Menschen mit beginnenden demenziellen Beeinträchtigungen gegründet.
Der Name – Promenz – wurde von den Betroffenen selbst definiert: Pro menz – also für den Geist. Die Initiative arbeitet konsequent aus der Betroffenenperspektive, bietet aber mittlerweile auch Unterstützung für Angehörige.
- Für Österreich & den gesamten deutschsprachigen Raum: Kostenlose Erstberatung, weiterführende Beratungsgespräche per Videocall oder Telefon (Kosten: 40 EUR pro Stunde)
- Gruppentreffen im 3. & 13. Bezirk/Wien, sowie in Klosterneuburg, Termine sind auf der Homepage ersichtlich
- Unterstützung für Angehörige:
- Online-Angehörigen-Sprechstunde für den gemeinsamen Austausch und thematische Inputs: jeden zweiten Montag 18-19.30 Uhr, Teilnahme via Zoome (Link auf promenz.at/angebote – kommende Termine auf promenz.at
- Raphael Schönborn steht auch gerne für Vorträge und Workshops zur Verfügung.
Mehr Informationen unter promenz.at.
Author: Anja Herberth
Chefredakteurin