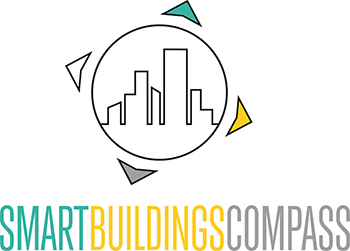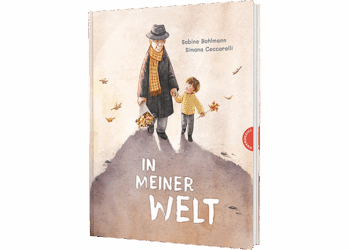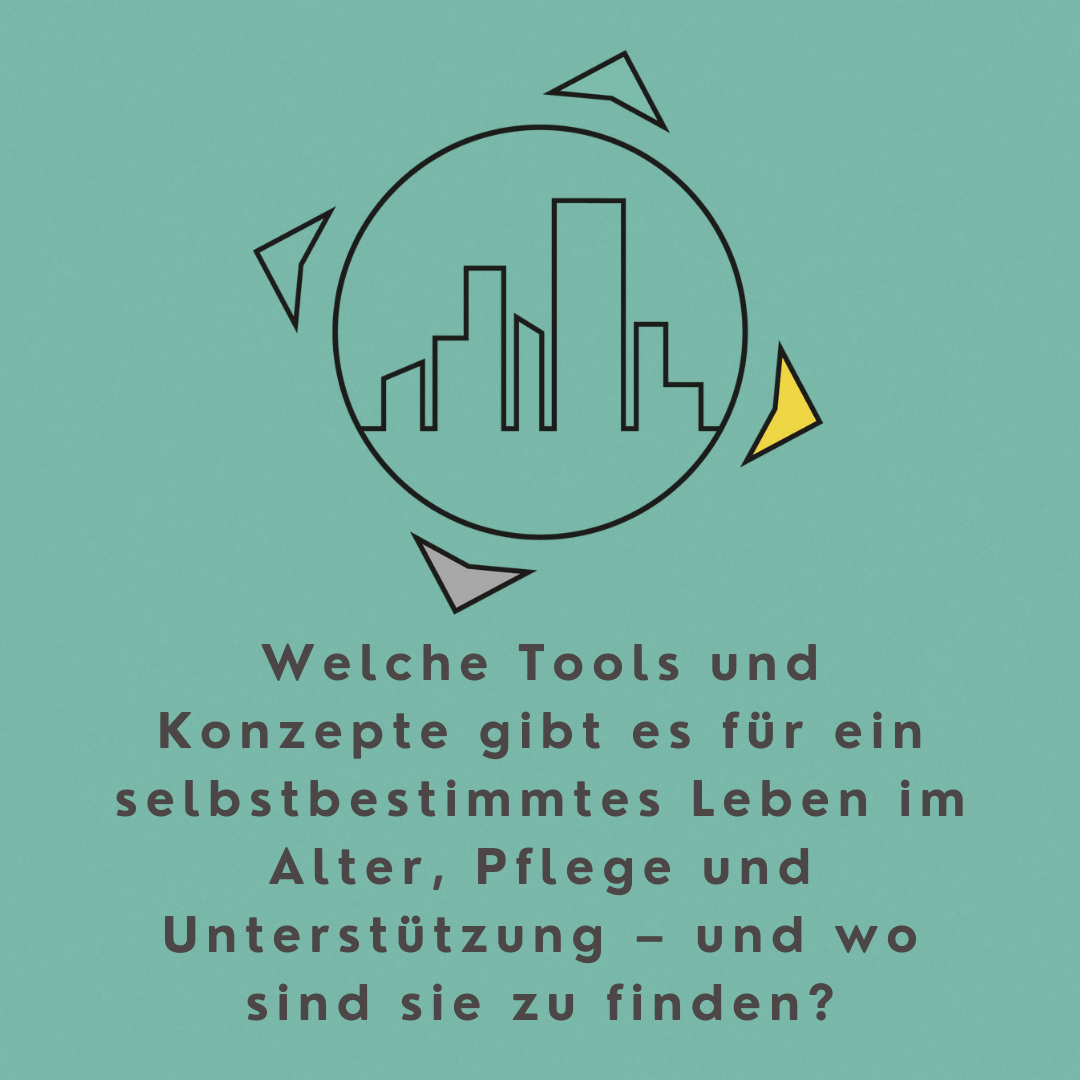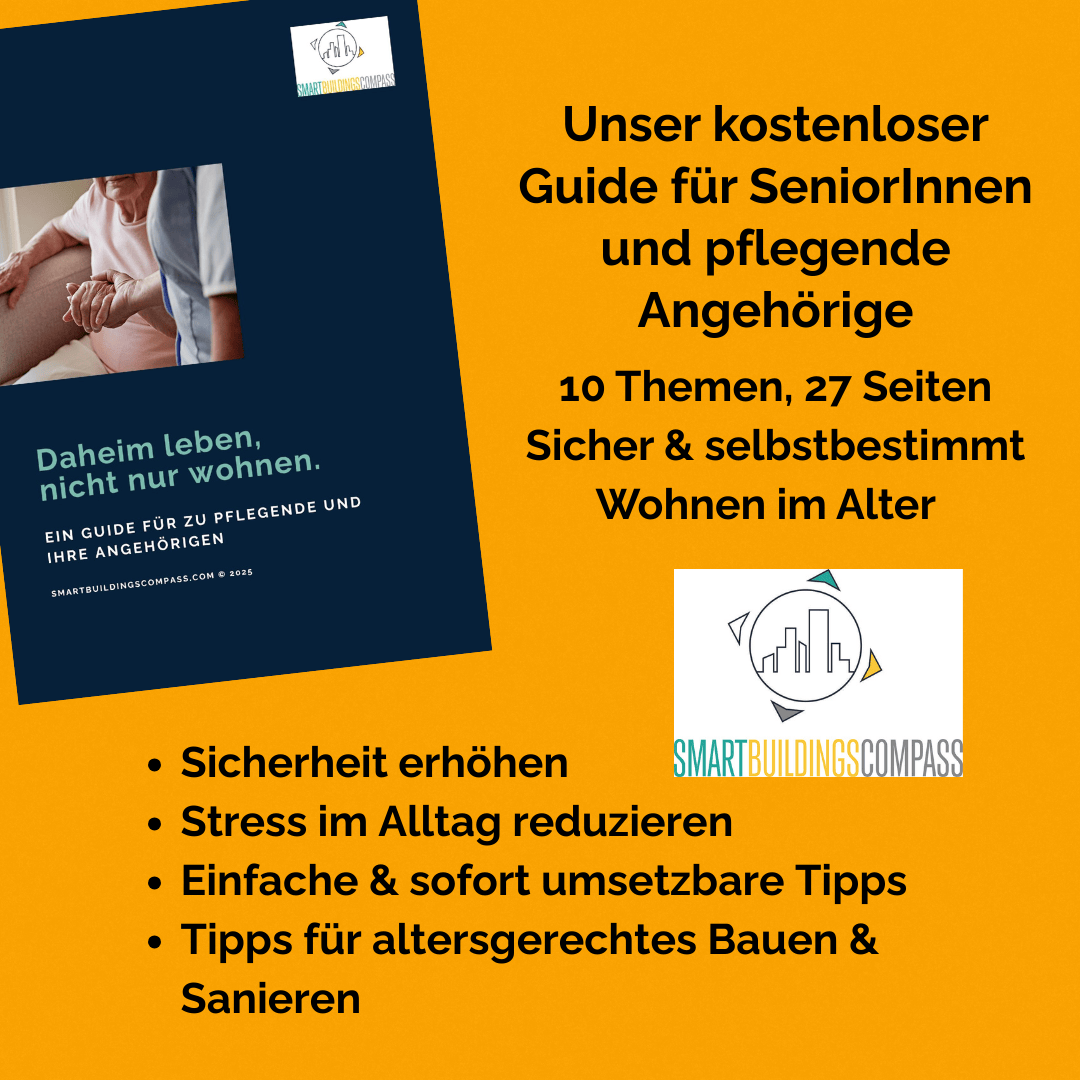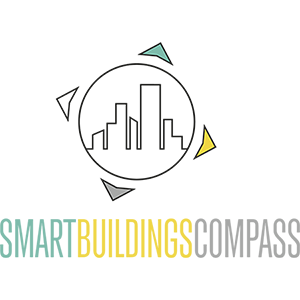This article is also available in:
English
Die HDI-Rentnerstudie 2025 zeigt auf: 57% der über 1.000 Befragten im Alter zwischen 63 und 70 Jahren sorgt sich zumindest teilweise um Altersarmut. Neben finanziellen Unsicherheiten offenbart die Erhebung auch eine oft unterschätzte emotionale Belastung vieler älterer Menschen: Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Befragten fürchtet, im Alter zur Last zu fallen. Da habe ich eine schlechte Nachricht: Die Pflege findet vor allem zu Hause statt. Und das nicht in der Zukunft, das ist heute schon Realität. Ein Kommentar von Anja Herberth.
Was wird mit mir, wenn ich alt bin? Besonders hoch ist diese Sorge bei jenen, die allein leben – immerhin 37 Prozent der RuheständlerInnen wohnen ohne Partner oder Familie, vor allem in Mietwohnungen. Fast die Hälfte (49 Prozent) aller befragten Ruheständler fürchten, einmal ein Pflegefall zu werden – aber 60 Prozent haben dafür keine Vorsorge getroffen.
Das soziale Netz, das einst selbstverständlich war, ist für viele heute brüchig geworden. Denn wir leben in einer Welt, in der Individualität und Selbstverwirklichung zu zentralen Werten geworden sind. Traditionelle Familienstrukturen und Rollenbilder lösen und verändern sich, Mobilität ist selbstverständlich geworden. Doch diese Freiheit hat auch ihren Preis – besonders, wenn es um Pflege und Unterstützung im Alter geht.
Individualisierung steht der notwendigen Vernetzung entgegen
Erst heute fiel in einem Gespräch mit einer deutschen Organisation ein Satz, der mich zum Nachdenken brachte: Der notwendigen Vernetzung und der Einbezug der Familie und des Quartiers, also der Nachbarschaft, in die Pflege steht die Individualisierung der Gesellschaft gegenüber. Laut HDI Rentnerstudie haben knapp drei Viertel (74 Prozent) der Befragten Kinder, aber es rechnet nur ein kleiner Teil wirklich mit ihrer Unterstützung. 56 Prozent erwarten nicht, dass ihre Kinder sie im Alter pflegen oder aktiv unterstützen werden.
Die Gründe dafür sind vielfältig: Räumliche Distanz, eigene berufliche Belastung, fehlende Ressourcen. Das Resultat ist ein Gefühl der Vereinzelung – gerade in einer Lebensphase, in der Nähe, Unterstützung und Fürsorge der Familie nicht nur besonders wichtig wären. Die Pflege und Unterstützung im Alter wird seitens der Politik gerade der Familie übertragen. Und das ist dort noch nicht angekommen.

Die Folgen des demographischen Wandels entfalten ihre Wirkung
Für diese Entwicklung sorgt die Mischung aus Fachkräfte- und Geldmangel in Kombination mit dem demographischen Wandel. 2025 wird seitens der OECD als das Jahr gesehen, in dem der kontinuierliche Anstieg der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter stoppt und dessen Rückgang beginnt. Heißt: Wir haben mittlerweile 2 Generationen in Pension (die Hochbetagten und deren Kinder – die Babyboomer-Generation) und viel zu wenige Fachkräfte, um diese Menschen zu betreuen. Und wenn wir genug Fachkräfte hätten, gäbe es immer noch zu wenig Geld, um diese zu bezahlen. Es gibt ja auch immer weniger Beitragszahler auf Grund des demographischen Wandels.
Mit der Verschiebung der Pflegeverantwortung in die Familien verknüpft ist der immer höher werdende Eigenanteil, der für die Pflege zu zahlen ist. Das belegt eine Erhebung des Verbandes der Ersatzkassen (vdek): Ein pflegebedürftiger Menschen muss im ersten Jahr in einem Heim inzwischen durchschnittlich 3.108 Euro jeden Monat selbst zuzahlen. Immer weniger Menschen können sich einen Platz im Pflegeheim leisten, und wer schon in einer Einrichtung lebt, wird laut dieser Erhebung „den Weg zum Sozialamt antreten.“
Das liest sich in österreichischen Erhebungen sehr ähnlich: Einer Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS) zufolge steigen die privaten Gesundheitsausgaben für österreichische Haushalte und sind teils nur schwer zu stemmen. Auf der einen Seite sei die Absicherung immer noch eine gute, allerdings werde es „für mehr Haushalte ungünstiger.“ Bedeutet: Es gibt eine schleichende Entwicklung, immer mehr Haushalte sind betroffen. Aktuell verarmen 2,8 % der Haushalte oder sind armutsgefährdet auf Grund der privaten Gesundheitskosten. Tendenz: Steigend.
Auch wenig verwundernd: Einer Studie des Verbands der Versicherungsunternehmen Österreichs zufolge sind 58% der ÖsterreicherInnen davon überzeugt, dass ihre staatliche Pension alleine nicht ausreichen wird, um den gewünschten Lebensstandard im Alter zu halten. Bei den Frauen sind es sogar rund zwei Drittel, bei den 30-39jährigen ist die Skepsis mit 61% ebenfalls hoch. Heißt: Der Umstand ist zumindest als Überschrift „Altersarmut“ bereits in der Bevölkerung angekommen.
Armut im Alter bedeutet nicht nur, nicht die notwendige Pflege zu erhalten – sie erhöht auch das Risiko, beispielsweise falsche Medikamente zu erhalten. Davon betroffen sind vor allem Frauen, die länger leben als Männer und denen durch den immer noch existierenden Pay Gap ihr ganzes Leben lang weniger Geld als Männern zur Verfügung steht. Und das gilt auch in der Pension: Die Armutsgefährdung ist für Frauen im Alter deutlich höher als für Männer.
Der Geldbeutel entscheidet über die Pflege
Was bedeutet das Auslagern der Pflege auf die Familien? Sie bedeutet, dass der individuell gefüllte Geldbeutel entscheidet, ob und welche Pflege zur Verfügung steht und wie gut die medizinische Versorgung ist. Und so plädiert nicht erst Dr. Alexia Zurkuhlen, Vorständin des Kuratoriums für Deutsche Altershilfe (KDA) für eine grundlegende Reform der Pflege und der Pflegefinanzen: „Es darf nicht sein, dass Pflege in Armut führt.“
Sollten Sie also dieser Tage etwas Verbindendes zwischen Deutschland und Österreich suchen, so sind Sie leider gerade fündig geworden. Beide Länder benötigen dringend eine Pflege-Reform, und in beiden Ländern stehen dazu entweder nur Überschriften im Koalitionsvertrag (Österreich), oder es wird sowieso auf eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe verwiesen (Deutschland), die sich mit einer Pflegereform befassen wird.
Alles in allem eine sehr schwache politische Vorstellung, die vor allem eines tut: Die Menschen im Land im Stich lassen. Denn Pflege betrifft alle Familien, und sie sind auf diese Situation nicht vorbereitet. Das Vertrauen in die Politik ist bereits stark angeschlagen – und das zaudernde Reagieren auf eine seit langem absehbare Entwicklung trägt kaum dazu bei, es wiederherzustellen.
Mehr dazu lesen:
HDI Rentnerstudie 2025: https://www.hdi.de
Kuratorium Deutsche Altershilfe – Pflege darf nicht in Armut führen: https://kda.de
IHS-Studie: Private Gesundheitsausgaben teils schwer zu stemmen
Author: Anja Herberth
Chefredakteurin