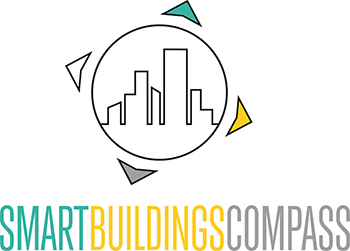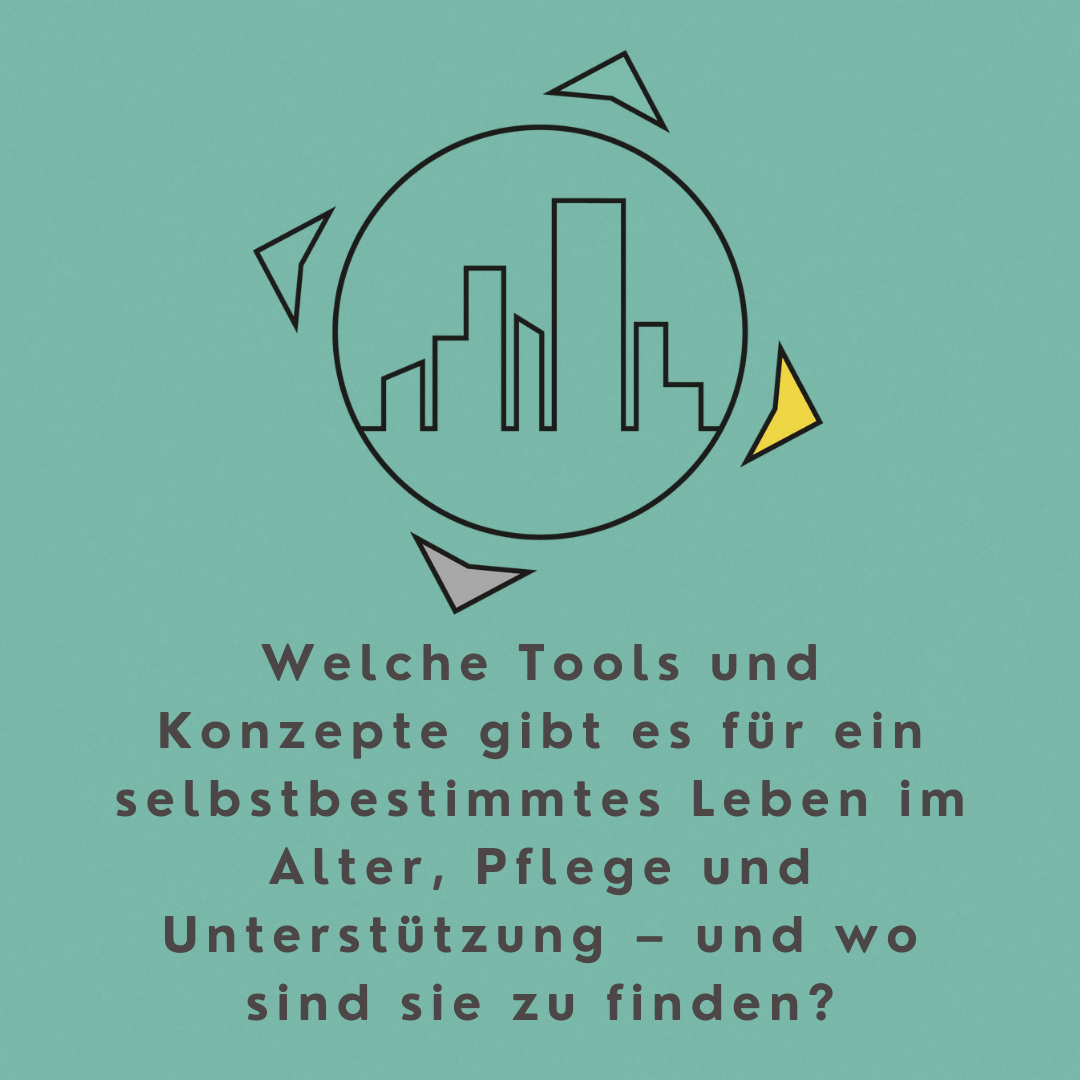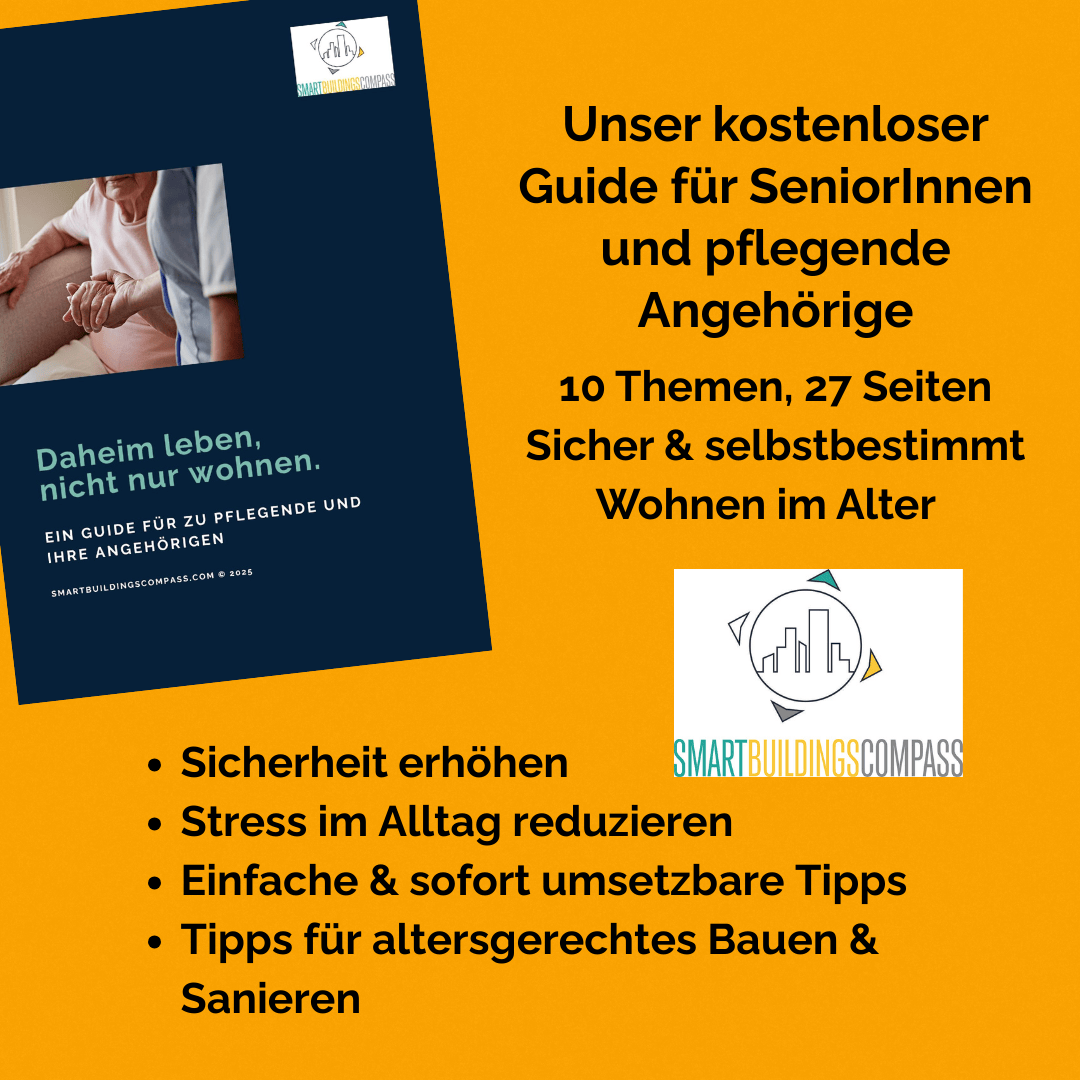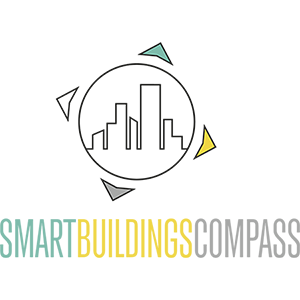This article is also available in:
English
Viele verbinden Krisenvorsorge mit großen Katastrophen. In der Praxis reicht oft ein kleines Ereignis: Ein Brand im Verteilerkasten ums Eck – und im Grätzl fällt der Strom aus. Im Interview erläutert Nicolas Tobaben, Bereichsleiter für Katastrophenschutz beim deutschen Johanniter Landesverband Nord, warum nicht der große Blackout der Maßstab für Krisenvorbereitung sein sollte. Es sind die kleinen, realistischen Szenarien direkt vor der eigenen Wohnungstür, auf die wir vorbereitet sein sollten.
Ein Gespräch über die Basics, um in den ersten 24 bis 48 Stunden handlungsfähig zu bleiben – und warum Krisenmanagement erst tragfähig wird, wenn wir für andere mitdenken.
SBC: Wie lässt sich Krisenvorsorge so vermitteln, dass sie EndkonsumentInnen wirklich erreicht? In vielen Interviews höre ich, dass genau das die größte Hürde ist: Solange nichts passiert, wirkt Vorbereitung abstrakt, kostet Zeit und Geld – und wird daher im Alltag kaum angegangen. Welche Ansätze halten Sie hier für wirksam?
Tobaben: Ich glaube, dass Menschen einen klaren Hinweis brauchen, sich überhaupt einmal mit dem Thema Vorsorge zu beschäftigen. Denn für das, wofür man vorsorgt, muss nicht gleich ein Umspannwerk brennen. Es reicht, wenn in der Nachbarschaft ein Verteilerkasten ausfällt. Solche Dinge passieren übrigens jeden Tag – sie sind nur nicht in den Medien, weil es vielleicht fünf Häuser betrifft und nicht gleich eine ganze Region. Für die Betroffenen ist es aber trotzdem real. Und genau deshalb kann es im Grunde jede Person jederzeit treffen.
Ich sage auch ganz offen: Niemand kann auf alles vorbereitet sein. Aber auf ein paar einfache Dinge kann man sich sehr wohl einstellen. Und das ist oft schon der Unterschied zwischen `komplett überfordert´ und `handlungsfähig´sein.
Und da bin ich auch realistisch: Nicht jeder Haushalt – schon gar nicht ein Ein-Personen-Haushalt in einer kleinen Wohnung – kann Vorräte für zehn Tage lagern. Die Empfehlung lautet zwar: Zwei Liter Wasser pro Person und Tag für zehn Tage, plus Lebensmittel. Das ist in der Praxis oft schwer unterzubringen.
Was aber immer möglich ist, sollte gemacht werden. Beispielsweise sich gedanklich vorzubereiten: Was könnte im Alltag bei mir passieren, und wie kann ich vor Ort damit umgehen. Was mache ich, wenn der Strom ausfällt? Was, wenn das Gas ausfällt? Und was viele unterschätzen: Wenn der Strom weg ist, fällt zumindest in Deutschland häufig auch das Wasser aus, weil Pumpen nicht mehr arbeiten. Dann geht es nicht nur ums Trinken, sondern auch um Hygiene. Ganz banal: Wie spüle ich die Toilette? Wie verhindere ich, dass sich in wenigen Tagen hygienische Probleme entwickeln? Dafür brauche ich Wasser – und da muss es nicht immer Trinkwasser sein. Für solche Zwecke kann man auch mit Brauchwasser-Lösungen arbeiten. Hauptsache, man hat sich vorher einmal damit beschäftigt, statt erst im Ernstfall improvisieren zu müssen.
Und der zweite Punkt: Wie kann ich damit umgehen, wenn ich meine Wohnung verlassen muss? Das sind genau die Szenarien, über die man viel zu selten nachdenkt, obwohl sie im Alltag am ehesten passieren: Es brennt bei den Nachbarn, Rauch zieht in die eigene Wohnung und man muss für ein, zwei Tage raus. Oder es brennt eine Etage darüber, die Feuerwehr löscht, und das Wasser läuft in die darunterliegenden Wohnungen. Plötzlich ist die eigene Wohnung vorübergehend nicht bewohnbar. Viele verbinden Notfallvorsorge sofort mit Blackout oder Großschadenslagen. Dabei reichen oft schon ganz alltägliche Ereignisse, und man muss die eigene Wohnung kurzfristig verlassen.
SBC: Welche Basics sollten nicht vergessen werden im Notfall – also wenn ich die Wohnung verlassen muss?
Tobaben: Für solche Situationen empfehlen wir ein kleines Notfallgepäck, das wir Fluchtrucksack nennen. Nicht, weil es um Flucht geht, sondern weil man im Zweifel kurzfristig umziehen muss. Es geht um die ersten 24 bis 48 Stunden, in denen man schnell handlungsfähig bleibt, ohne in Stress noch schnell alles zusammensuchen zu müssen. Und genau dafür gehören ein paar Basics hinein: Das Nötigste an Dokumenten und wichtigen Daten, Medikamente, etwas Bargeld, Lade- und Lichtquellen, Hygieneartikel sowie ein Satz Kleidung – also alles, was hilft, diese ersten Tage unkompliziert zu überbrücken, bis die Situation wieder geordnet ist.
Für mich ist bei der Zielgruppe der älteren Menschen ein Punkt wirklich zentral: Medikamente. Gerade ältere, pflegebedürftige Menschen mit Einschränkungen können nicht einfach `mal zwei Tage improvisieren.´ Wenn man die Wohnung kurzfristig verlassen muss, hilft es enorm, wenn im Notfallrucksack die wichtigsten Medikamente so vorbereitet sind, dass sie für die nächsten vier bis fünf Tage reichen – nicht perfekt einsortiert, aber verlässlich in ausreichender Menge dabei.
Ich erwarte gar nicht, dass jemand eine komplett sortierte Tagesdosette für morgens, mittags, abends und nachts im Rucksack hat. (Anmerkung: Eine Tagesdosette ist eine Medikamentenbox für einen Tag mit mehreren Fächern) Aber ich finde: Die Medikamente, die man regelmäßig braucht, sollten zumindest für ein bis zwei Tage fix vorbereitet sein – idealerweise länger. Denn Evakuierungen passieren nicht nur bei den großen Krisen: Ein Brand im Haus oder auch Bombenfunde können bedeuten, dass man sehr spontan für 10, 12, 24 oder 48 Stunden weg muss.
Und noch etwas: Selbst wenn Hilfe gut organisiert ist, ist sie am Anfang nicht sofort da. Wir dürfen nicht vergessen: Viele Kräfte arbeiten ehrenamtlich, kommen erst aus dem Berufsleben heraus, sind vielleicht sogar selbst betroffen. Hilfe baut sich erst Schritt für Schritt auf. Genau deshalb ist es für mich so wichtig, dass Betroffene die ersten ein bis zwei Tage überbrücken können – und dass der persönliche Bedarf, allen voran die Medikamente, dafür vorbereitet ist.

SBC: Ältere Menschen sind in Krisen eine sehr vulnerable Zielgruppe. Abseits von Notfallrucksack und Vorräten: Worauf sollten sie und pflegende Angehörige noch achten?
Tobaben: Ein weiteres Thema ist mindestens genauso wichtig: Netzwerke. Der Ausgangspunkt ist simpel, aber entscheidend: Es gibt Menschen, die haben Angehörige, die sich kümmern. Und es gibt Menschen, die hätten Angehörige, die sich kümmern könnten, aber im Alltag schlicht überfordert sind oder andere Prioritäten jonglieren. Ich nehme mich da selbst nicht aus: Man ist im eigenen Leben oft genug damit beschäftigt, alles irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Dann gibt es Menschen, die haben einen Pflegedienst, weil ein Pflegebedarf anerkannt ist und die Kostenträger das mittragen. Und dann gibt es jene, die all das nicht haben. Und genau diese Gruppe ist in Krisen besonders gefährdet. Es sind nicht automatisch die Älteren, die automatisch besonders gefährdet sind – sondern jene älteren Menschen, die keinen Pflegedienst haben, keine Angehörigen in der Nähe und niemanden, der im Zweifel einen Schlüssel hat oder regelmäßig nach ihnen sieht.
Es sind nicht automatisch die Älteren, die automatisch besonders gefährdet sind – sondern jene älteren Menschen, die keinen Pflegedienst haben, keine Angehörigen in der Nähe und niemanden, der im Zweifel einen Schlüssel hat oder regelmäßig nach ihnen sieht.
Für diese Menschen ist die Kernfrage: Wie komme ich an Kontakte, und wie komme ich an Informationen, wenn ich es selbst nicht kann? Und da sehen wir in Deutschland – und ich vermute, in Österreich ist das ähnlich: Gerade in Ballungsräumen leben viele ältere Menschen allein. Angehörige sind verstorben oder wohnen weit weg, der Freundeskreis wird kleiner, die Mobilität nimmt ab – und plötzlich ist man im Alltag schon isolierter. Wenn jemand eingeschränkt ist, nicht gut zur Tür kommt und gleichzeitig niemand organisiert ist, wird es schnell kritisch.
Deshalb ist das direkte Umfeld so entscheidend. Und zwar nicht nur, weil Betroffene aktiv werden sollen, sondern weil es enorm hilft, wenn Menschen bewusst Verantwortung in der Nachbarschaft übernehmen. Das beginnt ganz niedrigschwellig: `Soll ich dir die schweren Einkäufe mitbringen?` – `Soll ich im Winter den Gehweg miträumen?` – `Wenn du möchtest, übernehme ich auch mal den Stiegenhausdienst.` Aber es darf auch weitergehen, in Richtung Krisenfall: `Wie machen wir das, wenn der Strom ausfällt? Wie können wir dich erreichen? Hast du ein Zeichen, wenn du Hilfe brauchst? Dürfen wir im Zweifel zu dir kommen – und hast du Vertrauen, dass wir das dürfen?`
Manche sagen dann gern, früher war Nachbarschaft besser. Ich glaube, es ist weniger Nostalgie als Mathematik: Wir haben mehr ältere Menschen und weniger jüngere, die nachrücken. Das macht Netzwerke nicht automatisch schlechter. Aber es macht sie zu etwas, das man aktiv pflegen und organisieren muss, statt darauf zu hoffen, dass es sich von selbst ergibt.
Und wenn wir das schaffen, dann gilt für mich ein Satz, der es gut trifft: Wenn jede Person nur an sich denkt, ist noch lange nicht an alle gedacht. Erst wenn auch ein paar Menschen bewusst an andere mitdenken, wird es wirklich tragfähig. Genau dort entscheidet sich in der Praxis, ob jemand mitgetragen wird – oder ob jemand in der Krise schlicht übersehen wird.
SBC: Erleben Sie hier einen Unterschied zwischen Stadt und Land?
Tobaben: Ich lebe inzwischen auch eher ländlich – was ich aber wirklich spannend finde: Dieses Gefühl von `man kennt sich´ entsteht vor allem in den Ortsteilen. Wir haben fünf Ortsteile, und dort funktioniert Nachbarschaft oft noch sehr selbstverständlich. In unserer Siedlung, das sind rund 60 Parteien in einem Straßenzug, wissen wir ziemlich gut voneinander. Im besten Sinn: Die Kinder kennen sich über Schule und Alltag, man spricht miteinander, man hilft sich.
Da gibt es dann ganz praktische Dinge, die man im Ernstfall sofort merkt: Wer hat ein Haus, das halbwegs autark ist, weil es Strom vom Dach hat? Wo kann man im Zweifel auch nachts klingeln, wenn man etwas dringend braucht? Und wenn bei uns etwas Medizinisches passiert, dann klingelt mein Telefon – einfach, weil das Netzwerk da ist und greift.
Sobald ich aber nur ein Stück weitergehe, Richtung Hochhäuser im nächsten Ortsteil, kippt das deutlich. Dort funktioniert diese Selbstverständlichkeit viel weniger. Und ehrlich gesagt: Das erlebe ich überall ähnlich. Je anonymer und dichter die Strukturen, desto mehr muss Nachbarschaft aktiv organisiert werden, und sie entsteht nicht von allein.
Je anonymer und dichter die Strukturen, desto mehr muss Nachbarschaft aktiv organisiert werden, und sie entsteht nicht von allein.
SBC: Gehen wir über zur Kommunikation: Wie informiere ich mich, wenn nichts mehr geht, der Strom ausgefallen ist?
Tobaben: Beim Thema Information ist mein klarer Rat: Radio hören. In den meisten europäischen Ländern laufen Warnmeldungen heute zwar zusätzlich über Mobilfunk – Stichwort Cell Broadcast – aber darauf kann man sich eben nicht allein verlassen. (Anmerkung: Cell Broadcast ist ein Katastrophenwarnsystem, das Notfallmeldungen direkt auf Mobiltelefone sendet. Es funktioniert ohne App-Download und ist bei höchster Warnstufe oft auch nicht deaktivierbar). Nicht alle Menschen haben ein Mobiltelefon, und schon gar nicht alle ein Smartphone. Gerade ältere Personen nutzen oft einfache Tastentelefone und dort kommen solche Warnmeldungen teilweise gar nicht oder nicht in der Form an. Deshalb braucht es einen zweiten, robusten Kanal.
Ein Radio ist genau so ein Kanal. Idealerweise eines, das batteriebetrieben ist und im besten Fall sogar mit Kurbel funktioniert. Spannend ist, dass viele Menschen, die heute 90 Jahre alt sind, diese Lösungen noch kennen. Diese Generation hat große Krisen erlebt. Sie wissen, wie sich das anfühlt, und sie geraten bei Sirenen oder Stromausfall oft weniger in Panik als man erwarten würde. Ich habe das selbst erlebt bei meiner Großmutter, sie war Jahrgang 1930. Als wir ihre Wohnung ausgeräumt haben sind Dinge aufgetaucht, die kannte nicht einmal ich, obwohl ich mich fachlich auskenne. Diese Generation bringt eine gewisse Resilienz mit, weil sie solche Situationen schon einmal durchgestanden hat.
Die größere Herausforderung sehe ich eher bei unserer Generation und bei noch Jüngeren: Viele haben so etwas noch nie erlebt. Wenn dann plötzlich Sirenen gehen, die Heizung ausfällt und das Netz instabil wird, fehlt oft die Einordnung und damit auch die Ruhe, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das hat man bei Ereignissen wie in Berlin auch sehr deutlich gesehen.
SBC: Mir ist in meinen Gesprächen aufgefallen, dass freiwillige HelferInnen fachlich sehr engagiert sind, im Krisenfall aber auf die besonderen Bedürfnisse älterer, gebrechlicher und mobilitätseingeschränkter Menschen oft nur begrenzt vorbereitet wirken. Häufig wird betont, man behandle alle gleich – was aus meiner Sicht in solchen Situationen nicht ausreicht, weil unterschiedliche Voraussetzungen auch unterschiedliche Unterstützung brauchen.
Gibt es in Deutschland konkrete Kursangebote oder Programme, die Sie freiwillig Engagierten empfehlen würden, damit sie sich in ihrer Region gezielt weiterbilden können – insbesondere mit Blick auf Evakuierung und die Unterstützung vulnerabler Gruppen?
Tobaben: Man schaut von außen oft auf Einsatzkräfte und denkt: „Die sind doch die Helfer – die müssen im Ernstfall einfach alles können.“ Ich verstehe diesen Reflex, aber er stimmt so nicht. Niemand kann alles können, und genau deshalb arbeiten wir im Katastrophenschutz mit Fachdiensten und klaren Rollen.
Die `weißen´ Hilfsorganisationen – also Sanitäts- und Rettungsdienste – nähern sich Menschen grundsätzlich aus der Perspektive PatientIn bzw. betreuungsbedürftig. Wer körperliche Einschränkungen hat, wird dort schnell als jemand gesehen, der Versorgung oder Betreuung braucht. In der Pflege spricht man von BewohnerInnen oder – in der ambulanten Pflege – teils technisch von KundInnen. Im Sanitätsdienst ist das dann wieder anders: Dort geht es nicht um KundInnen, sondern um medizinische Versorgung. Und die Feuerwehr hat wiederum andere Aufgaben und Kompetenzen. Diese Differenzierung ist wichtig, weil sie erklärt, warum Zusammenarbeit so zentral ist: Jede Organisation bringt ihr eigenes Fachwissen ein.
Neben den klassischen Blaulichtstrukturen gibt es aber noch eine zweite Gruppe, die in Krisen eine enorme Rolle spielt: Spontanhelfende. Das sind Menschen aus der Region – manchmal auch weit darüber hinaus, die sagen: „Ich komme selbst zurecht, und ich will helfen. Sagt mir nur, wie.“ Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal kamen diese HelferInnen aus ganz Deutschland. Wenn diese Hilfe gut koordiniert ist, ist sie ein riesiger Gewinn. Wenn Menschen unkoordiniert einfach irgendetwas machen, kann es allerdings auch schwierig werden, auch das haben wir in vergangenen Ereignissen sehr deutlich gesehen.
Genau deshalb gibt es in Deutschland eine Kurssystematik des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), die darauf abzielt, die eigene Resilienz zu stärken – und gleichzeitig Menschen überhaupt erst in die Lage zu versetzen, anderen sinnvoll zu helfen. Das Programm besteht aktuell aus mehreren Modulen für unterschiedliche Zielgruppen und Altersgruppen, von kurzen Einheiten in Kindergarten und Volksschule über Kurse für Jugendliche bis hin zu spezifischen Formaten für Menschen mit besonderen Bedürfnissen.
Besonders relevant in Ihrem Kontext sind zwei Module: Eines für pflegende Angehörige und eines für beruflich Pflegende. Dort geht es sehr konkret darum, wie man handelt, wenn Infrastruktur ausfällt – etwa Strom, Heizung, Kommunikation – und wie man in Pflege- und Betreuungssituationen trotzdem handlungsfähig bleibt.
Und das ist für mich der praktische Take-away: Wer sich vorbereiten will, muss nicht sofort das ganze Leben umkrempeln. Ein guter erster Schritt ist, sich umzusehen, wo es in der eigenen Region solche Kurse gibt – und sie zu nutzen. Das, was man dafür mitbringen muss, ist im Grunde vor allem Zeit und die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Alles andere ergibt sich dann Schritt für Schritt.
Vielen Dank für das Interview!
Checkliste & Infos zur Notfall-Vorsorge: „Vorsorgen für Krisen und Katastrophen“
Mehr zu den Kursen vom deutschen Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
Author: Anja Herberth
Chefredakteurin