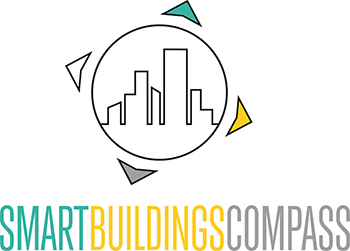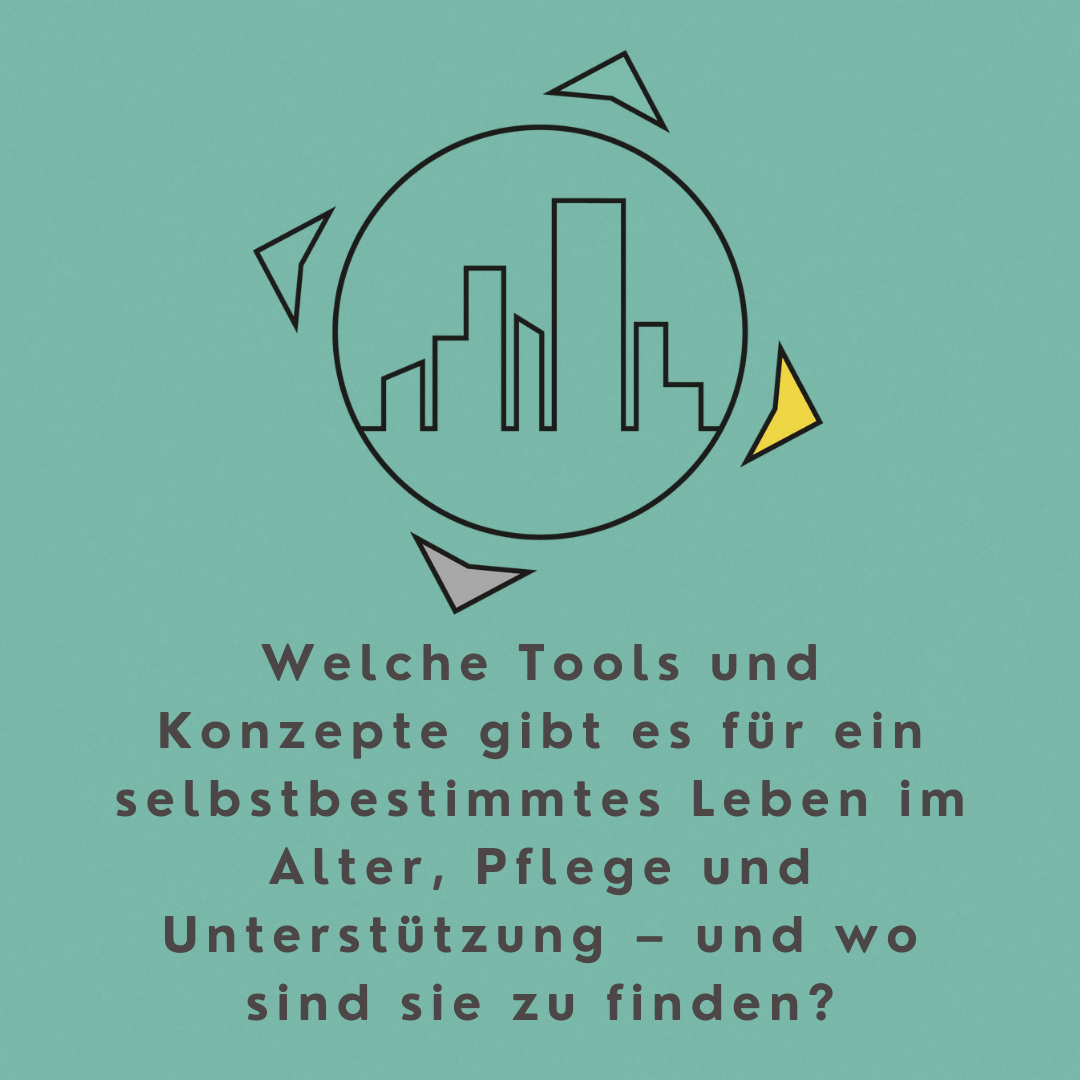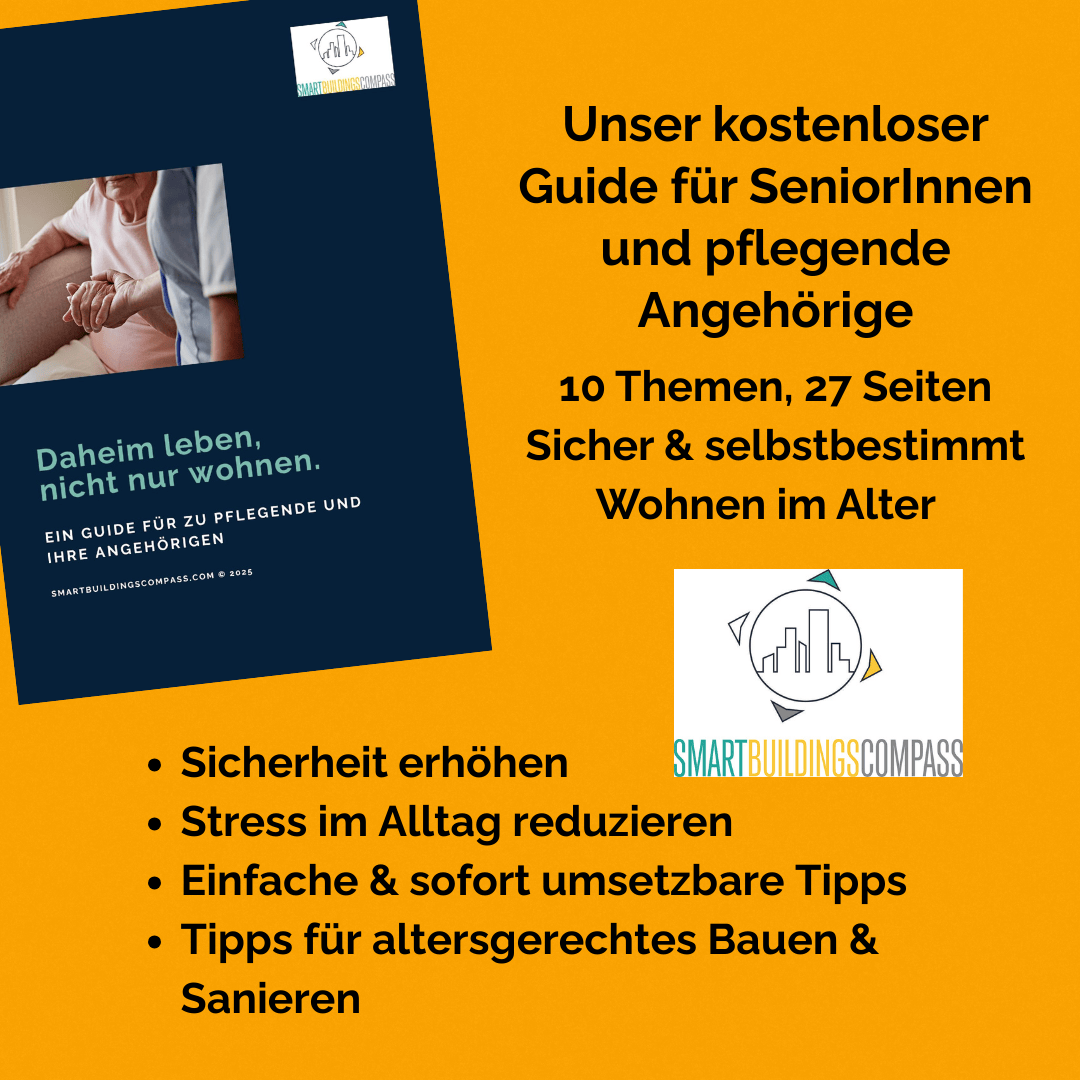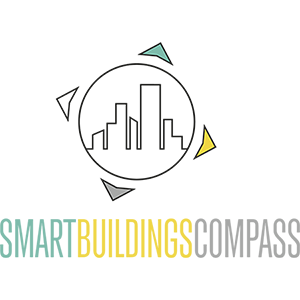This article is also available in:
English
Hier geht’s zu den Interviews im Detail
Nach dem Anschlag auf eine Stromversorgungsleitung in Berlin begann die Analyse und die entscheidende Frage: Was hat funktioniert – und was nicht? Und wer – welche Organisationen und Zielgruppen – muss seine Vorbereitung dringend verbessern?
Denn Krisen treffen nicht alle gleich. Für manche ist ein Stromausfall `unangenehm´. Er bedeutet Kälte, wachsende Unsicherheit in dem Moment, in dem man merkt, wie viele Selbstverständlichkeiten an Strom hängen: Neben Heizung auch Warmwasser, Herd, Toiletten, Licht, Aufzug. Und – ganz leise, aber entscheidend – verabschiedet sich das Gefühl von Kontrolle. Für Haushalte, in denen zu Hause gepflegt wird, können diese Vorfälle rasch existenziell werden: Medikamente, Geräte, Routinen, Kommunikation – viele kleine Bausteine müssen zuverlässig ineinandergreifen. Wenn diese Kette reißt, wird aus einem Vorfall schnell ein Notfall.
Wir haben deshalb recherchiert, welche Tools, Checklisten und Informationsangebote für Haushalte mit Pflege- und Betreuungsbedarf bereits existieren – und welche Learnings aus den Krisen der vergangenen Jahre vorhanden sind. Unser Ziel ist nicht der nächste Ratgeber und die nächste Checkliste, sondern Kontext und Orientierung: Vorhandenes bündeln, einordnen und so aufbereiten, dass es schnell auffindbar und im Alltag nutzbar ist. Wenn wir besser vorbereitet sein wollen, müssen wir das vorhandene Wissen besser verbinden und verständlicher dorthin bringen, wo es im Ernstfall zählt.
Denn eines ist nach Krisen immer wieder klar: Vieles ist da – aber zu wenig sichtbar. Auch die Awareness, dass es eine Vorbereitung braucht, ist nicht immer vorhanden.
Wir haben mehrere Interviews mit ExpertInnen aus Deutschland und Österreich geführt und uns daher dazu entschlossen, neben einem zusammenführenden Teil auch die einzelnen Interviews zur Vertiefung zur Verfügung zu stellen. Denn neben ganz zentralen Punkten, die alle als besonders essentiell betrachten, sind es erst die unterschiedlichen Sichtweisen und Details, die ein Gesamtbild ermöglichen.
Unsere InterviewpartnerInnen
Krisen treffen nicht alle gleich – und daher braucht es eine Anpassung der Krisenvorsorge auf die ganz persönliche Lebensrealität.
Unsere InterviewpartnerInnen erklären den Kontext – und worauf Sie als pflegender Haushalt besonders achten müssen.
Hier geht’s zu den Interviews im Detail.
Wir haben die zentralen Aussagen aus den Interviews für Sie aber auch gebündelt – als kompakten Überblick darüber, was in der Krisenvorbereitung wirklich zählt und welche Zusammenhänge man dabei im Blick behalten sollte:
Es sind nicht immer die großen Krisen: Kleine regionale Ausfälle gibt es immer wieder
Es sind nicht immer die großen Stromausfälle, wodurch plötzlich das Licht ausgeht, keine Heizung mehr funktioniert. Wenn der Verteilerkasten ums Eck ein Problem hat, Hochwasser, Sturmschäden, Schneelasten: Kleinere regionale Ausfälle gibt es immer wieder. Und genau dafür gilt es, sich zu rüsten.
Resilienz entsteht dort, wo die Vorbereitung zur persönlichen Situation passt
Resilienz bedeutet nicht Unverwundbarkeit – also nicht die 100%ige, perfekte Abwehr jeder Krise. Resilienz heißt, in einer Störung handlungsfähig zu bleiben: Zu improvisieren, sich anzupassen und nicht in Angst oder Überforderung zu kippen. Dazu gehört auch, das eigene Netzwerk zu kennen – Familie, Nachbarschaft, regionale Anlaufstellen – und zu wissen, wie Organisationen im Notfall arbeiten und wo man Unterstützung bekommt.
All das steht in allgemeinen Ratgebern oft nur am Rande. Sie sind eine wertvolle Orientierung, aber entscheidend ist etwas anderes: Vorbereitung wirkt erst dann, wenn sie zur persönlichen Situation und zum Umfeld passt. Welche Rahmenbedingungen prägen meinen Alltag? Gibt es Unterstützung in der Nähe – oder bin ich auf mich allein gestellt? Arbeitet die Familie vor Ort oder pendelt sie, und wie schnell kann sie im Ernstfall da sein? Lebe ich in einer Wohnung oder in einem Haus – mit welchen Konsequenzen muss ich bei einem Stromausfall für Aufzug, Heizung oder Wasserversorgung rechnen? Kenne ich meine Nachbarinnen und Nachbarn, und ist der Kontakt so tragfähig, dass im Notfall jemand nach mir sieht?
Diesen individuellen Zuschnitt braucht es auch bei Medikamenten und Vorräten. Gerade Menschen mit Erkrankungen sind auf regelmäßige Einnahmen angewiesen. Hier lässt sich in Krisen nur begrenzt improvisieren, zumal Apotheken und Lieferketten bei Stromausfällen durch Automatisierung und Digitalisierung selbst anfällig sein können. Sinnvoll ist daher eine kleine Reserve zumindest für einige Tage.
Und auch bei Lebensmitteln gilt: Individualisierung schlägt Theorie. Wer weiß schon, was sich in einer Stresssituation aus 10 Kilo Mehl und 5 Kilo Linsen am Gaskocher realistisch zubereiten lässt? Der pragmatische Ansatz ist meist der beste: Kaufen Sie etwas mehr von dem, was Sie ohnehin essen und gut vertragen. Lagern Sie nach dem „First in, first out“-Prinzip (Neues nach hinten, Älteres nach vorne), damit nichts verdirbt. Setzen Sie außerdem auf Lebensmittel, die mit wenig Energie rasch zubereitet sind – Nudeln und Reis sind oft praktikabler als Speisen mit langen Kochzeiten oder Backrohrbedarf. So bleibt die Versorgung auch dann stabil, wenn Alltag und Infrastruktur kurzfristig wackeln.
Grundsätzlich gilt: Netzwerk & Beziehung vor Ausrüstung
Im ländlichen Raum sind unterstützende Netzwerke oft selbstverständlich und eng mit dem Alltag verwoben. Während man in Städten nicht selten in der Anonymität untergeht, sind solche Hilfestrukturen am Land entscheidend, um Lücken z.B. in der Versorgung und Infrastruktur auszugleichen. Gegenseitige Unterstützung wird hier zu einer zentralen Voraussetzung für Lebensqualität und Sicherheit. Auch beim großen Stromausfall in Berlin zeigte die Nachbarschaftshilfe, was sie kann: Da wurde gemeinsam bei Kerzenschein Karten gespielt, die frierenden Nachbarn in Wohnungen eingeladen, in denen ein Kamin wohltuende Wärme spendete. Man lud zum Duschen und Wäschewaschen ein.
Das persönliche Netzwerk trägt, wenn der Alltag plötzlich chaotisch wird. Daher sind nicht automatisch alle Älteren besonders gefährdet, sondern jene ältere Menschen, wo weder einen Pflegedienst, Angehörige oder Nachbarn nach ihnen sehen. Dieses Netzwerk baut sich tragfähig in guten Zeiten, im Alltag auf. Die Basis dafür ist das bewusste Mitdenken von anderen, wie Nicolas Tobaben erklärt: „Wenn jede Person nur an sich denkt, ist noch lange nicht an alle gedacht. Erst wenn auch ein paar Menschen bewusst an andere mitdenken, wird es wirklich tragfähig.“ Je anonymer und dichter die Strukturen, desto mehr muss Nachbarschaft aktiv organisiert werden und sie entsteht nicht mehr allein.
Das gilt nicht nur für die informellen Netzwerke: Auch in den professionellen Strukturen ist das Netzwerk entscheidend, wie reibungslos die Zusammenarbeit und Kommunikation der Organisationen in einer Krise funktioniert.

Die ältere Generation ist oft resilienter als die Jüngeren
Resilienz zeigt sich nicht in Zeiten, in denen alles läuft. Sie zeigt sich dann, wenn das System bereits wackelt – und wir trotzdem einen Weg finden, das Wesentliche zu sichern. Präventiv, das sagen mir die InterviewpartnerInnen, machen EndkonsumentInnen kaum etwas. Nicht, weil es unwichtig wäre, sondern Vorbereitung Zeit, Geld und Aufmerksamkeit braucht. Und weil niemand sicher weiß, ob man die Vorbereitung jemals braucht – gerade in Friedenszeiten, in denen Stabilität selbstverständlich wirkt.
Vorsorge hat ein Kommunikationsproblem: Sie belohnt nicht sofort, sie fordert jetzt und `zahlt´ erst später aus. Genau deshalb sind wir so häufig nicht ausreichend vorbereitet, wenn aus einer Störung plötzlich eine Krise wird.
Die ältere Generation ist körperlich & medizinisch häufig vulnerabler, hat hier aber einen entscheidenden Vorteil: Sie hat bereits viel erlebt. Viele Menschen haben noch den zweiten Weltkrieg als Kinder erlebt, wuchsen unter Verzicht und großen Herausforderungen auf. Daher kennt die ältere Generation noch Tipps und Tricks und wirkt in manchen Aspekten gelassener und vorbereiteter als die jüngere Generation. Viele haben noch beispielsweise Radios im Keller, die mit Batterie betrieben werden können.
Resilienz ist in den Regionen sehr unterschiedlich aufgebaut
Die Gespräche haben eines sehr deutlich gemacht: Resilienz ist regional sehr unterschiedlich ausgeprägt. Was in der einen Gegend Alltag ist, kann anderswo sofort zum Problem werden – ein paar Zentimeter Schnee reichen in Städten oft für Chaos, während in Skiregionen dieselbe Wetterlage eher als willkommener Neuschnee gilt.
Hinzu kommt die föderale Organisation des Krisenmanagements in Deutschland und Österreich: Zuständigkeiten, Vorgaben und Vorbereitungslogiken liegen maßgeblich bei den Bundesländern. Das bedeutet in der Praxis, dass je nach Bundesland unterschiedliche Regeln, Konzepte und Abläufe gelten – sowohl in der Prävention als auch im konkreten Krisenfall.
Struktur statt Prinzip Hoffnung
Weder in Deutschland noch in Österreich gibt es ein flächendeckendes Pflegeregister, über das Einsatzkräfte im Krisenfall rasch erkennen können, wo zu Hause besonders unterstützungsbedürftige Menschen leben. Informationen liegen oft dezentral bei Betreuungsorganisationen – und genau dort können sie bei Stromausfällen oder Systemstörungen im Ernstfall schwer zugänglich sein. Wer bislang nicht erfasst ist, weil der Alltag noch ohne formale Unterstützung funktioniert, kann in einer Krise leicht übersehen werden.
Es gibt allerdings freiwillige Ansätze: etwa das internationale Verzeichnis notfallregister.eu oder lokale Modelle wie ein freiwilliges Pflegeregister im deutschen Landkreis Wesermarsch (für Menschen ab Pflegegrad 3). Abseits solcher Lösungen sind offizielle, vollständige Register jedoch rechtlich heikel – insbesondere wegen Datenschutz und DSGVO. Das führt dazu, dass Einsatzkräfte zu Beginn eines Ereignisses oft nicht wissen, wo besonders schnell Hilfe gebraucht wird.
Zusätzlichen Aufholbedarf gibt es in der Katastrophenpflege. Während Blaulichtorganisationen, Bundesheer sowie Zivil- und Katastrophenschutz meist klar strukturiert arbeiten, sind die zivilen Gesundheits- und Versorgungsstrukturen – etwa Langzeitpflege und mobile Pflege – häufig weniger systematisch auf Krisen vorbereitet. Es fehlt vielerorts an klaren Rollen, abgestimmten Abläufen und koordinationsfähigen Schnittstellen.
Zwar gibt es vereinzelt Fachpersonen mit entsprechender Spezialausbildung, doch oft fehlt der Überblick: Wer ist qualifiziert, wo ist diese Person tätig, und wie ist sie im Ernstfall erreichbar? Genau hier setzt das Profil der Disaster Nurse an: Sie koordiniert im Krisenfall innerhalb von Einrichtungen, verbindet Versorgung und Einsatzstrukturen und übersetzt zwischen den unterschiedlichen Logiken und Zuständigkeiten.
Wenn Krisenereignisse – etwa durch Extremwetter – häufiger werden, reicht spontane Improvisation als Systemprinzip nicht mehr aus. Was es braucht, ist planbare, trainierte Handlungsfähigkeit: klar benannte Rollen, geübte Schnittstellen und Menschen, die im Ereignisfall nicht erst ordnen müssen, sondern sofort koordinieren können.
Wenn Sie tiefer einsteigen möchten: Zu diesem bündelnden Überblick stellen wir auch die einzelnen Interviews in voller Länge zur Verfügung. Denn erst im Detail wird sichtbar, wie unterschiedlich Perspektiven, Praxisbeispiele und Prioritäten sind – und welche konkreten Schritte sich daraus für den eigenen Alltag ableiten lassen. Nehmen Sie sich gern die Zeit: Jedes Gespräch ergänzt das Gesamtbild um Nuancen, die in einer Zusammenfassung zwangsläufig verloren gehen – und genau dort liegt oft der größte Nutzen.

Nicolas Tobaben erklärt uns, warum ältere Menschen in Krisen nicht automatisch am stärksten gefährdet sind. Sondern vor allem jene, die allein leben, keine Angehörigen in der Nähe haben, noch keinen Pflegedienst nutzen und niemanden haben, der nach ihnen sieht.
Am Land funktioniert Nachbarschaftshilfe oft noch selbstverständlicher, in Ballungsräumen leben dagegen viele ältere Menschen isoliert. Gerade dort gilt: Tragfähig wird Krisenvorsorge erst, wenn Menschen bewusst an andere mitdenken – denn je anonymer und dichter die Strukturen, desto aktiver muss Nachbarschaft organisiert werden. Hier geht’s zum Interview

Für alle, die – so wie wir – ehrlich nicht wissen, was man im Krisenfall mit 10 Kilo Mehl und 5 Kilo Linsen am Gaskocher anfangen soll: Dieses Interview ist eine echte Rettungsleine.
Christoph Sterbenz erklärt, wie ein Familiennotfallplan funktioniert, warum eine Krisenvorsorge immer zur eigenen Lebenssituation passen muss und warum gerade bei älteren Menschen ein persönliches Netzwerk dahinter stehen sollte. Er erklärt uns, welches Mindset im Krisenfall hilft und wie man die Bevorratung so organisiert, dass sie auch in der Krise funktioniert. Hier geht’s entlang zum Interview

Elisabeth Potzmann plädiert für mehr durchdachte Strukturen – statt dem Prinzip Hoffnung zu folgen. Denn Bundesheer, die Blaulichtorganisationen sowie Zivil- und Katastrophenschutz sind hervorragend ausgebildet – die zivilen Gesundheits- und Versorgungsstrukturen wie z.B. Langzeitpflege und mobile Pflege sind deutlich schlechter aufgestellt.
Dafür gäbe es das Berufsbild der Disaster Nurse – die Katastrophenpflege. Diese speziell geschulten Personen sind aber in der zivilen Versorgungsstruktur noch nicht verankert. Hinzu kommt, dass es (weder in Österreich, noch beim deutschen Nachbarn) ein Pflegeregister gibt: Die Einsatzkräfte wissen nicht wo Menschen sind, die in Krisen akut Hilfe benötigen. Weiters sind Krisen nicht immer großflächig, sondern auch persönlich: Für eine Übergangspflege fehlen oftmals die Strukturen, aber es gibt Bewegung in diesem Thema. Hier geht’s entlang zum Interview

Sr. Cornelia verantwortet nicht nur das Krisenmanagement ihrer Gemeinschaft: Sie bringt Erfahrung aus deutschen bundesweiten Projektgruppen zur Krisenvorsorge ein, ist Gründungsmitglied der deutschen Bundesinitiative für Vernetzte Gefahrenabwehr.
Mit ihr sprechen wir über einfache, alltagstaugliche Maßnahmen, um ältere Menschen auf eine Krise vorzubereiten, ohne zu überfordern – und wo Sie sich dafür Hilfe holen können. Auch Sie betont die Wichtigkeit von Vernetzung – für ältere Menschen, insbesondere mit einer Demenzerkrankung, aber auch für Organisationen wie Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste. Ein Konzept ist nur belastbar, wenn im Vorfeld geklärt wird, wer im Ernstfall mit wem kooperiert. Hier geht’s entlang zum Interview

Christian Gamsler erklärt, wie das Bundesland Kärnten regionale Resilienz aufbaute – nachdem 2016 festgestellt wurde, dass die Vorsorgestrukturen auf Grund der langen Friedensperiode stark reduziert und ausgelagert wurden.
Damit die Regionen sich selbst helfen können, falls Hilfe nicht sofort ankommen kann, wurden in den Regionen Gemeindehäuser und Schulen zu Krisenanlaufpunkten konzipiert und mobile Notstromaggregaten gefördert. Auch für Pflege- und Betreuungseinrichtungen wurde eine Notstromversorgung verpflichtend.
Und auch er rät die 3 K’s: In der Krise Köpfe kennen. Ohne Vernetzung geht es in der Krise nicht – weder für EndkonsumentInnen, noch für die Profis. Und die werden in guten Zeiten aufgebaut. Hier geht’s entlang
Author: Anja Herberth
Chefredakteurin