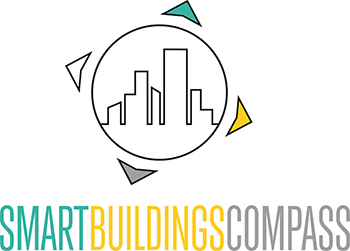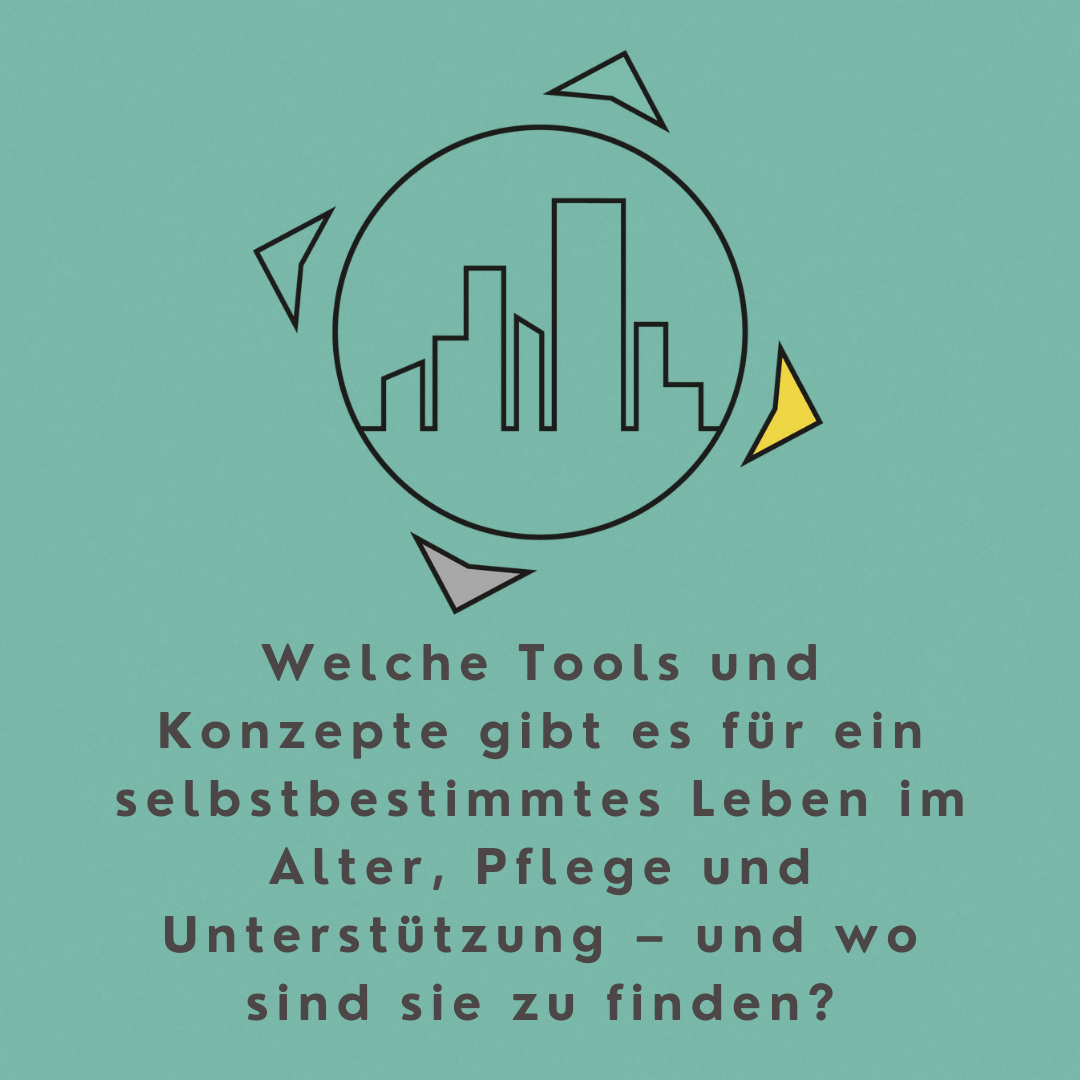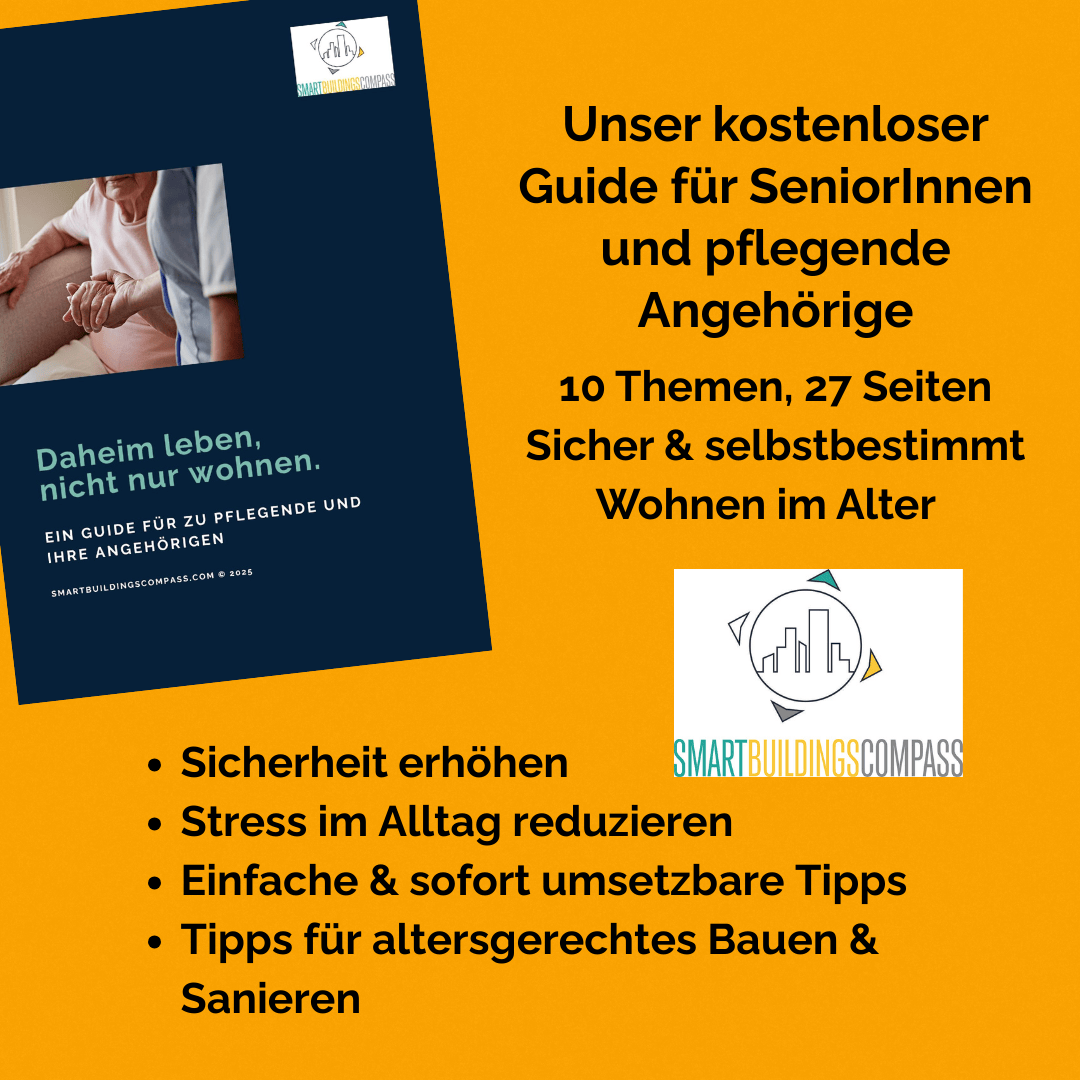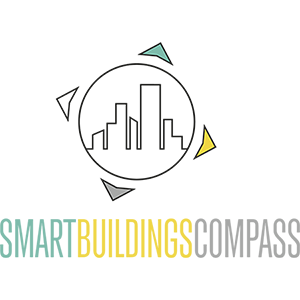This article is also available in:
English
Die Vision klang vielversprechend: Masdar City sollte das ökologische Vorzeigeprojekt der Emirate werden. Die Öko-Stadt der Zukunft, in der die Energie ausschließlich aus Sonne und Wind produziert wird. In der es keine Emissionen und nahezu keinen Abfall gibt, in der innovative Mobilitätskonzepte das eigene Auto obsolet machen.
Der notwendige Energie-Aufwand pro Kopf sollte nur mehr bei einem Viertel des heutigen Verbrauchs liegen. Im Jahr 2008 gestartet, sollte das Projekt ursprünglich 2016 fertig werden – nun wurde die Fertigstellung auf 2030 verschoben. Das erste Match Realität vs. Vision ging 1:0 für die Realität aus.
Was wir uns am Konzept dennoch ansehen können: Welche baulichen Maßnahmen zum Hitzeschutz und für die sparende Ressourcennutzung verwendet wurden. Denn die Architekten haben sich alte, traditionelle Konzepte der Region zu nutzen gemacht. Denn Hitzeregionen wissen schon lange, wie sie sich vor hohen Temperaturen schützen.
Von Aufbruchstimmung nichts mehr über
Vor Ort ist vor allem die Stille ohrenbetäubend. Vom Plan einer ganzen Stadt ist nur ein Bruchteil umgesetzt, von der anfänglichen Aufbruchstimmung ist nichts mehr über. Die kleine Siedlung, einst vom britischen Stararchitekten Sir Norman Foster geplant, wirkt wie eine Geisterstadt, einsam und verlassen. Wir treffen nur wenige Menschen auf unserem Rundgang.
So ist die International Renewal Energy Agency eingezogen und – nur wenig verwunderlich – auch das staatliche Nuklearunternehmen ENEC hat seinen Hauptsitz in Masdar aufgeschlagen. Atomenergie wurde erst kürzlich seitens der EU als Brückentechnologie anerkannt, um den Umstieg auf nachhaltige Energiequellen zu schaffen.
Auf den ersten Blick wirkt das Stadtkonzept in Masdar stimmig, es vereint alte Tradition mit neuer Technologie: In Arabien wurden seit jeher die Häuser dicht beieinander gebaut. Dadurch spenden sie sich gegenseitig Schatten und können sich von vornherein nicht zu sehr erhitzen. Die Gebäude in Masdar sind klein, kompakt und nur wenige Stockwerke hoch. Die Planer haben die Häuser wie eine „Düse“ angelegt, sodass ein angenehmer Wind durch die Straßen weht. Der Wind wird aktiv durch die Stadt gelenkt, trotz den heißen Wüstentemperaturen hat es in den Straßen von Masdar angenehm kühle Temperaturen.
Während wir in Europa große Fenster gewohnt sind, gibt es in diesem Konzept keine direkte Sonneneinstrahlung, um Hitze im Gebäude erst gar nicht entstehen zu lassen. Die Fenster sind zurückgesetzt eingelassen, Lichtschächte und Fensterschlitze geben Helligkeit, Luftkissen dämmen und lassen die heißen Temperaturen außen vor. Für eine zusätzliche Lichbrechung sorgen Pflanzen und dunkel gefärbte Glasfaser-Betonplatten. Ein Windturm fängt den kühlen Wind ein und lüftet die Straßen. Sonnensegel schützen vor direkter Sonneneinstrahlung, Wasser fließt über Steinbrunnen und sorgt durch Verdunstungskälte für eine natürliche Kühlung.
In den Gassen ist kein einziges klassisches Auto zu sehen – der Plan war ein anderer: Die wichtigsten Spots sollten zu Fuß schnell erreichbar sein. Wer dennoch einen fahrbaren Untersatz braucht, sollte auf selbstfahrende Autos und Busse zurückgreifen können. Das System erwies sich aber als zu teuer, da dafür Leitungen in den Boden verlegt werden mussten. Gäste können dieses Konzept dennoch auf kleinen Testtrecken ausprobieren.
Holz – ein Baustoff trotzt aggressivem Klima?
Holz wird in den Emiraten als Baustoff so gut wie gar nicht verwendet: Das Klima ist dafür zu aggressiv – zumindest bei direkter Sonneneinstrahlung, die Sandstürme tun ihr übriges. Von einem Holz-Liegestuhl, den man im Garten vergisst, bleibt innerhalb kürzester Zeit nicht besonders viel über.
Eines der Gebäude von Sir Norman Foster ist dennoch ein Holzbau. Solange keine direkte Sonneneinstrahlung auf das Holz wirkt, belegt dieser Bau, dass in Wüstenregionen auch ohne Beton gebaut werden kann. Global werden jährlich über 4,6 Milliarden Tonnen Zement verbaut, bei der Herstellung fallen an die 2,8 Milliarden Tonnen CO2 an. Das sind fast acht Prozent der weltweiten Emissionen und damit mehr als Flugverkehr und Rechenzentren zusammen ausstoßen. Angesichts der erhöhten Nachfrage in den Schwellenländern könnte dieser Wert in den kommenden Jahren noch steigen.
Derzeit formiert sich laut einem Architekten in den Emiraten eine Initiative, die den Baustoff Holz in den Fokus rücken möchte. Einfach wird dieser Prozess nicht: Holzhäuser haben es in den Emiraten schwer, überhaupt genehmigt zu werden.
Warum Masdar City heute noch nicht funktioniert
Das Konzept wirkt gut durch durchdacht, und ist ein spannender Gegenpol zu den gewaltigen Bauten in den Emiraten. Daher denke ich, dass hier viel zu früh aufgegeben wurde: Durch die klimatischen Veränderungen werden wir uns in vielen Regionen dieser Welt überlegen müssen, wie wir unsere Häuser kühl halten – und nicht nur, wie wir sie heizen. Das wird die Art und Weise, wie wir Bauen und Sanieren, komplett verändern – auf lange Sicht betrachtet.
In offiziellen Statements wird die Weltwirtschaftskrise als Hauptgrund für die Verzögerung genannt. Das Projekt startete ausgerechnet im Frühjahr 2008, also in dem Jahr, in dem Lehman Brothers zusammenbrach. Diese Erklärung ist für die ersten Jahre nachvollziehbar, erklärt aber die Verschiebung der Finalisierung in das Jahr 2030 nicht.
Aus den Gesprächen ist herauszuhören, dass man mit einem viel schnelleren Erfolg des Businessmodells gerechnet hatte. Das Hauptproblem liegt daher viel eher im Umstand, dass nachhaltiges Bauen und Sanieren nur langsam in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Auch das Klima ändert sich, es wird wärmer. Auch das wird die Art und Weise, wie wir bauen und sanieren, verändern. Allerdings langsamer als gedacht: Masdar war schlicht viel zu früh am Markt und seiner Zeit voraus.
Offizielle Homepage: www.masdarcity.ae/
Author: Anja Herberth
Chefredakteurin