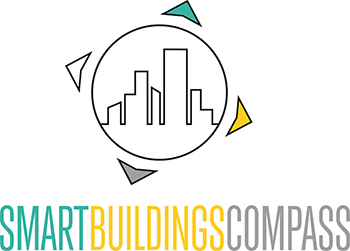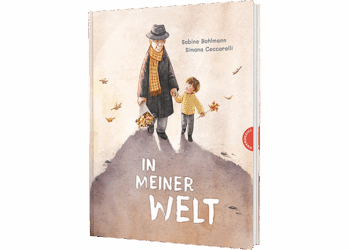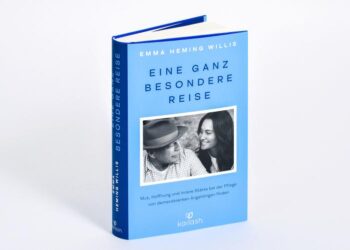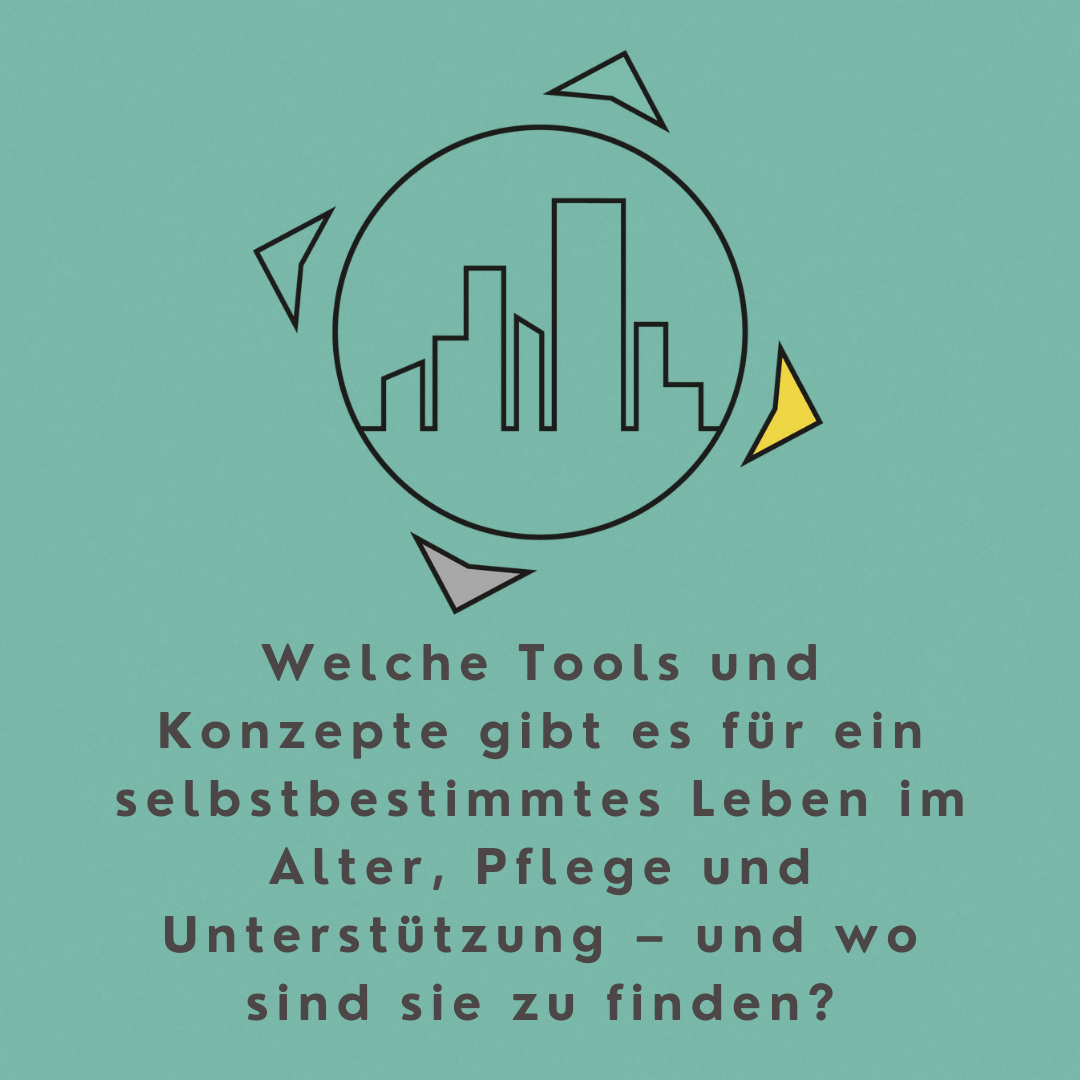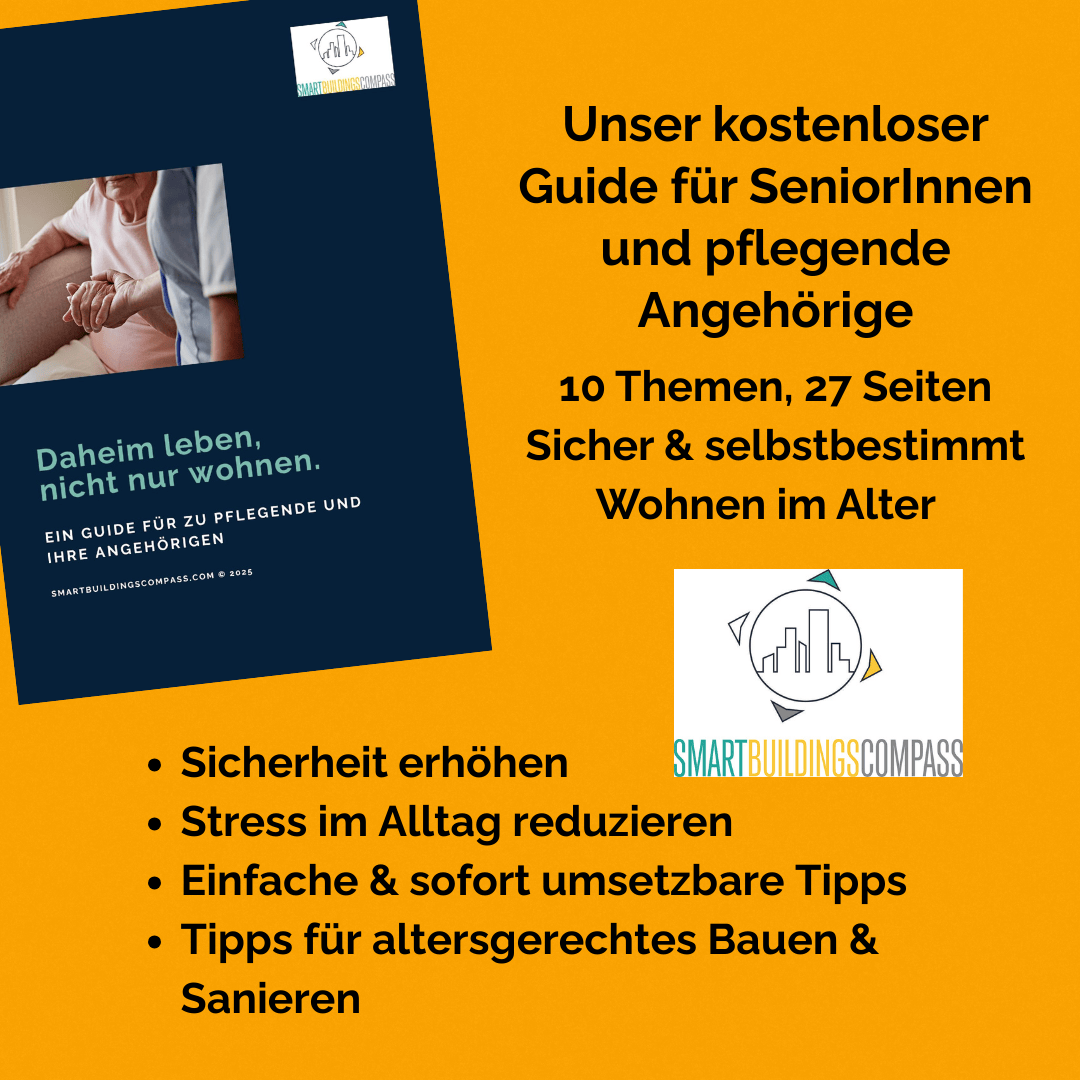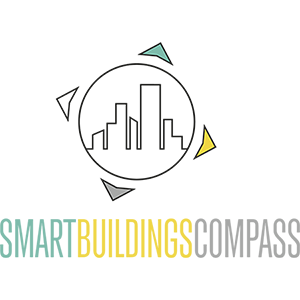This article is also available in:
English
In Zeiten des demografischen Wandels und zunehmender Vereinsamung im Alter gewinnen Tageszentren an Bedeutung. Sie bieten älteren Menschen Struktur, soziale Kontakte, gezielte Betreuung und vor allem eines: Teilhabe am Leben.
Meine Interviewpartnerin Marianne Buchegger ist Leiterin des Tageszentrums am Wiener Rennweg und wir haben Sie gefragt: Wann macht der Besuch eines Tageszentrums Sinn, was bieten diese Einrichtungen, und wie tragen sie zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bei?
Wann ein Tageszentrum Sinn macht
Tageszentren sind für Marianne Buchegger ein unverzichtbares Angebot in einer modernen Stadtstruktur. „Sie bieten eine wertvolle Unterstützung für ältere Menschen mit und ohne Demenzerkrankung sowie für deren Angehörige“, betont Buchegger. „Tageszentren ermöglichen es Menschen, länger selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu leben.“
Warum wir uns dem Thema Tagespflege widmen:
Tageszentren gewinnen zunehmend an Bedeutung, und sie sind weit mehr als bloße Betreuungseinrichtungen: Tageszentren schaffen Begegnung, ermöglichen Teilhabe und schenken älteren Menschen Struktur und Lebensfreude. Gerade angesichts wachsender Einsamkeit im Alter bieten sie einen sicheren und unterstützenden Rahmen — für Menschen mit und ohne Demenzerkrankung. Sie entlasten zudem Angehörige, die häufig vielfältige Rollen zwischen Familie, Beruf und Pflege jonglieren.
Wir möchten mit diesem Beitrag aufzeigen, welche Chancen Tageszentren bieten, wie sie funktionieren und warum sie für viele Familien eine wertvolle Unterstützung sein können. Denn: Teilhabe am Leben und Lebensfreude sollte für alle möglich bleiben — bis ins hohe Alter.
Doch wie funktioniert das konkret? Tageszentren sind teilambulante Angebote. Die Gäste kommen in der Regel am frühen Vormittag, meist mit einem Fahrtendienst oder auch selbständig im Tageszentrum an. Dort verbringen sie den Tag gemeinsam mit anderen Gästen: Bei abwechslungsreichen Aktivitäten, gemeinsamen Mahlzeiten und im sozialem Austausch. Am Nachmittag werden sie wieder nach Hause gebracht.
Gerade dieser strukturierte, gemeinschaftliche Rahmen trägt dazu bei, dass ältere Menschen weiterhin im eigenen Zuhause bleiben können — was für viele ein Herzensanliegen ist. Ein zentrales Thema ist dabei die Einsamkeit. „Einsamkeit ist heute ein großes Problem. Nicht nur in Großstädten, sondern zunehmend auch im ländlichen Raum“, erklärt Buchegger, „Tageszentren leisten hier einen wichtigen Beitrag: Sie schaffen Orte der Begegnung und der gesellschaftlichen Teilhabe. Oft kommen Familien zu uns, weil sie merken, dass die Großmutter oder der Großvater zu Hause zunehmend vereinsamen. Im Tageszentrum blühen viele ältere Menschen wieder auf.“
Für Tageszentren gibt es auch nur wenige Hürden, auf die man achten müsste: „Es ist weder eine Pflegestufe, noch ist ein spezieller Krankheitsbefund notwendig. Es gibt natürlich Tageszentren wie beispielsweise das Multiple Sklerose Tageszentrum der CS Caritas Socialis, wo eine Diagnose da sein muss. Aber in allen anderen Tageszentren können Menschen mit und ohne Demenzerkrankung Tagesgäste werden“, betont Buchegger.
Die Dichte an Tageszentren ist in Wien besonders hoch: „Wir sind in Wien in der komfortablen Situation, in jedem Bezirk mindestens ein Tageszentrum zu haben“ so Buchegger. Drei werden seitens der Caritas bespielt, alle weiteren von anderen Anbietern. Die Wiener Tageszentren werden für alle Personen mit Hauptwohnsitz in Wien seitens der Stadt gefördert und stehen allen älteren Menschen offen.
Wie ein erster Tag abläuft
Wer sich unsicher ist, ob ein Tageszentrum das Richtige sein könnte, kann auf zwei Arten ganz unkompliziert einen ersten Eindruck gewinnen. Viele Einrichtungen bieten die Möglichkeit, das Angebot in entspannter Atmosphäre kennenzulernen. Marianne Buchegger: „Wenn jemand zu uns kommen möchte, ist der erste Schritt immer ein Kennenlernen. Ich lade Interessierte und ihre Familien ein, einfach einmal auf einen Kaffee zu uns zu kommen.“ Bei diesem Besuch erzählt das Team vom Alltag im Tageszentrum und führt die Gäste durch die Räume.
Dieses persönliche Kennenlerngespräch ist für Buchegger ein ganz zentraler Baustein – gerade bei Menschen mit Demenzerkrankung: „Die Erfahrung zeigt, dass das erste Gespräch und die Führung ganz wichtig sind für den Beziehungsaufbau und das Vertrauen. Besonders bei Menschen mit Demenz braucht es diese Möglichkeit, sich langsam und sicher an das neue Umfeld heranzutasten.“
Eine weitere Möglichkeit, den Alltag im Tageszentrum kennenzulernen, ist bei CS Caritas Socialis der Schnuppertag. Es wird gemeinsam Kaffee getrunken, je nach Lust und Laune Aktivitäten besucht, das Mittagessen genossen. Nach diesen Eindrücken wird dann gemeinsam entschieden, ob die Besuche in eine Regelmäßigkeit überführt werden oder ob es beispielsweise noch einen Schnuppertag braucht, um einen Eindruck vom Alltag zu erhalten.
„Wie sage ich meiner Großmutter, dass sie Unterstützung braucht?“
Der Schritt ins Tageszentrum ist oft eine große Hürde, erklärt Buchegger: „Es ist für viele eine Herausforderung zu sagen: ‚Ich gehe da jetzt hin.‘ Denn es bedeutet auch, sich einzugestehen, dass sich etwas verändert hat.“ Eine zusätzliche Unsicherheit entsteht häufig durch die räumliche Nähe vieler Tageszentren zu Pflegeeinrichtungen.
Gerade deshalb ist es so wichtig, Ängste frühzeitig anzusprechen und abzubauen. Für Angehörige ist der Weg zu einem Tageszentrum oft eine lange und emotionale Reise. Viele versuchen über Monate hinweg, den geliebten Menschen für das Angebot zu gewinnen — manchmal ohne Erfolg. Das Kennenlerngespräch und der Schnuppertag helfen dabei, Vertrauen aufzubauen und mögliche Sorgen zu klären: „So entsteht bei vielen sehr schnell ein gutes Gefühl – und echte Vorfreude auf den ersten Besuch.“
Marianne Buchegger versteht diese Zurückhaltung, denn älter werden ist immer auch mit Verlusten verbunden: „Das Leben ist nicht mehr so, wie es war. Und in der eigenen Wahrnehmung bin ich aber noch so wie ich war. Das macht es so schwer, Veränderungen zuzulassen.“ Für Angehörige ist es deshalb wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, in welcher emotionalen Situation sich die Betroffenen befinden: „Es geht nicht nur um den Bedarf, sondern um den Schmerz der Veränderung. Zu akzeptieren, dass das Leben sich verändert hat — das ist ein tiefer Prozess, der begleitet werden muss.“
Ein Tageszentrum kann hier ein behutsamer neuer Schritt sein. Aber es braucht Verständnis, Geduld — und vor allem das Wissen: „Der Mensch, der kommt, bringt seine Geschichte, seine Verluste und seinen Schmerz mit.“
Die unsichtbare Last der Angehörigen: Warum auch sie Unterstützung brauchen
Nicht nur die Betroffenen sind von Veränderungen betroffen. Auch ihre Angehörigen erleben diesen Wandel – oft schmerzhaft und ambivalent.
Marianne Buchegger beschreibt dieses doppelte Verlusterleben sehr eindrucksvoll: „Die Angehörigen erleben, dass sich etwas verändert.“ Dieser Prozess braucht Zeit, und die emotionale Auseinandersetzung ist bei Angehörigen oft genauso intensiv wie bei den betroffenen älteren Menschen selbst: „Bis man das wertschätzen und annehmen kann, dauert es bei Angehörigen genauso lang und intensiv wie bei den Menschen, die im Prozess selbst sind – ob mit oder ohne Demenzerkrankung.“
Im Team der CS Caritas Socialis achtet man deshalb bewusst darauf, beide Seiten im Blick zu behalten: „Sowohl die Familien als auch die Menschen, die zu uns kommen, sind in einem eigenen Prozess, mit eigenen Betroffenheiten und Bedürfnissen.“ Das Verständnis für diese doppelte Belastung ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit im Tageszentrum. Denn nur wenn beide Seiten begleitet werden, entsteht ein Raum, in dem neue Perspektiven und Entlastung möglich sind.
Für pflegende Angehörige ist dieser Spagat besonders herausfordernd: „Es ist eine der größten Herausforderungen, das eigene Verlusterleben auszuhalten – und gleichzeitig den anderen in seinem Verlusterleben zu unterstützen und auch das auszuhalten.“ Dieser Balanceakt führt unweigerlich zu einem emotionalen Spannungsfeld und hohen Herausforderungen: „Gerade bei einer Demenzentwicklung gibt es in diesen Prozessen sehr viel Auf und Ab. Als begleitende Personen müssen wir das mittragen und den Angehörigen Mut machen, sich auch selbst Unterstützung zu holen.“
Die vielen Rollen der oft weiblichen pflegenden Angehörigen
Die Rolle der Pflege ist immer noch stark weiblich: Während die Zahl der pflegenden Männer zwar wächst, tragen Frauen nach wie vor die Hauptlast. Das beobachtet Marianne Buchegger immer wieder — sowohl in ihrem beruflichen Alltag als auch im eigenen Umfeld: „Selbst in sehr reflektierten Familiensystemen sehen wir: Die Sorgearbeit liegt zum Großteil bei den Töchtern, Schwiegertöchtern und Enkelinnen.“
Umso wichtiger ist es, die vielfältigen Rollen, in denen sich pflegende Angehörige bewegen, bewusst wahrzunehmen: „Pflegende Angehörige haben oft viele Rollen gleichzeitig. Sie sind Mutter, Ehefrau, Organisatorin, Pflegerin, Assistentin, emotionale Stütze – und nicht zuletzt eine trauernde Person.“ Gerade bei der Begleitung von Menschen mit Demenz verstärkt sich diese emotionale Belastung noch: „Ein Leben mit einem Menschen mit Demenz ist ein langer Abschied. Man braucht viel Kraft, viel Zeit und viel Unterstützung – sonst ist es kaum zu schaffen.“
Zum Glück, so Buchegger, gibt es heute mehr Angebote für pflegende Angehörige als noch vor einigen Jahren. Bei Selbsthilfegruppen und psychologischer Begleitung beginnend bei politischen Interessensvertretungen wie die IG Pflege bis hin zu konkreten Entlastungsangeboten wie den kostenlosen psychologischen Hausbesuchen (z.B. über das österr. Sozialministerium Service).
Was dabei oft fehlt, ist das Bewusstsein für die eigene Belastung. Buchegger appelliert deshalb an Angehörige, sich ihre vielen Rollen immer wieder bewusst zu machen: „Je klarer ich für mich sehe: Jetzt bin ich gerade bedürftig, ich brauche Ruhe, ich brauche Unterstützung – desto besser kann ich damit umgehen. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, sich selbst nicht zu vergessen.“
Denn nur wer sich selbst schützt, kann den langen Weg der Begleitung wirklich durchhalten — und dabei auch für sich selbst gesund und stabil bleiben. Buchegger abschließend: „Gerade dafür sind Tageszentren eine wertvolle Ressource: Sie entlasten die Angehörigen und schaffen Freiräume, damit diese in ihrer Kraft bleiben können. Gleichzeitig beziehen sie die Betroffenen aktiv mit ein und ermöglichen so allen Beteiligten mehr Lebensqualität.“
Vielen Dank für das Interview!

Mehr Informationen zur Tagespflege in Wien finden Sie beim Fonds Soziales Wien www.fsw.at.
Mehr zu Marianne Buchegger: Marianne Buchegger leitet das Tageszentrum für SeniorInnen und Menschen mit Demenz am Wiener Rennweg. Weiters leitet sie den Lehrgang „Begleiten bei Demenz“ im Kardinal König Haus Wien und Koordinatorin für den demenzfreundlichen 3. Wiener Gemeindebezirk.
Als Blogbeauftragte von Hospiz Österreich finden Sie online regelmäßig Blogbeiträge von Marianne Buchegger, z.B. auf derstandard.at: Demenz braucht Gemeinschaft
Author: Anja Herberth
Chefredakteurin