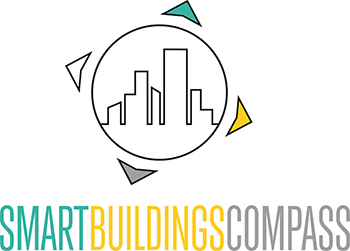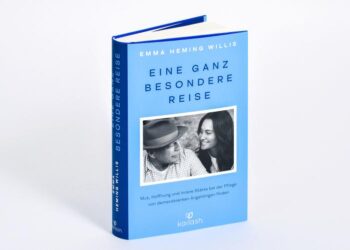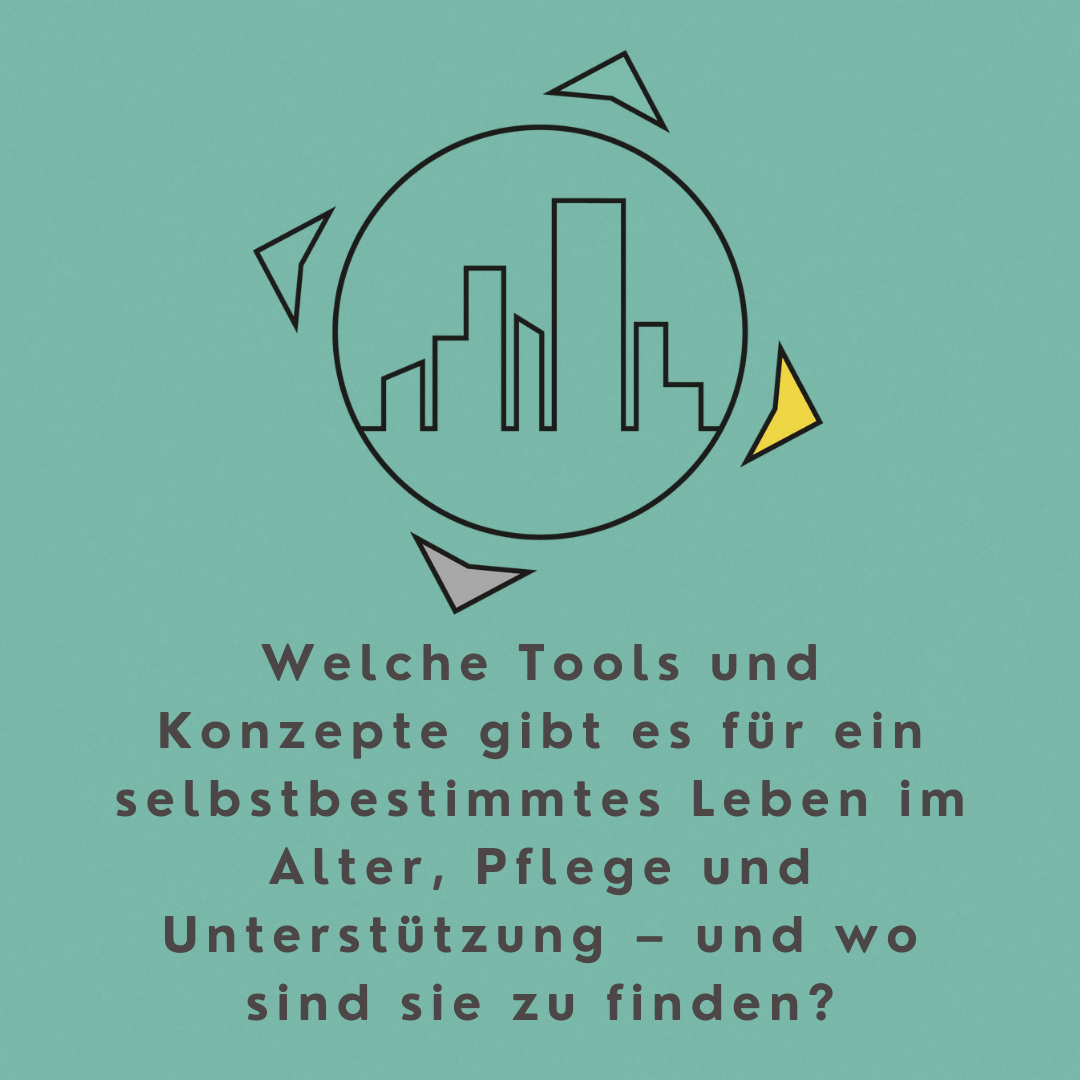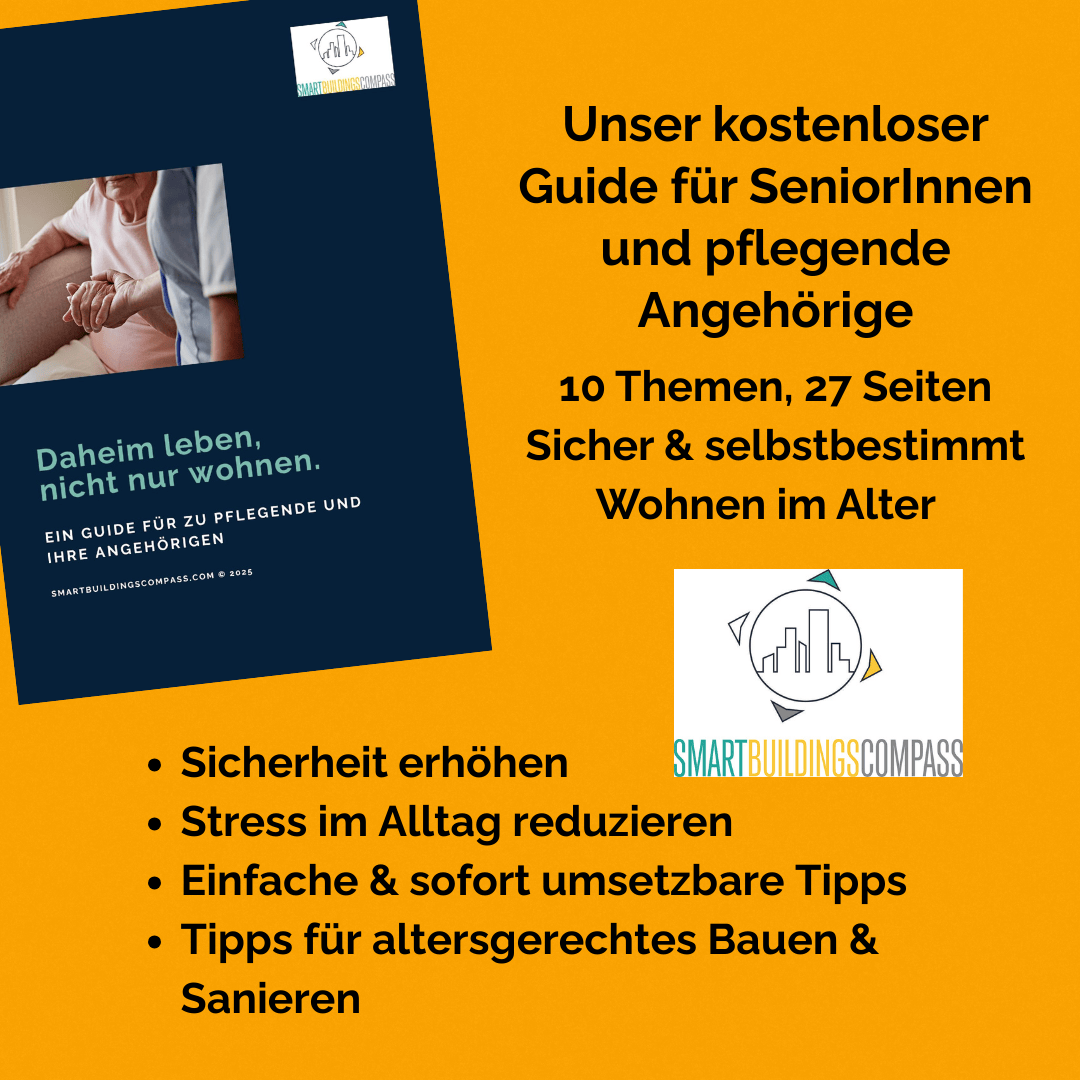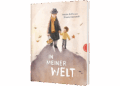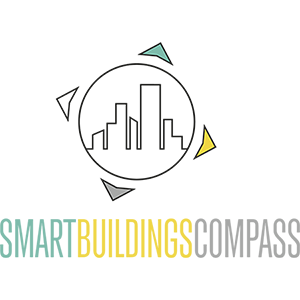This article is also available in:
English
Eine aktuelle Studie in eBioMedicine, ein peer-reviewtes Lancet-Journal für biomedizinische Forschung, zeigt: Schlechter Schlaf hängt mit einem „älteren“ Gehirn zusammen. Ausgewertet wurden 27.500 MRT-Aufnahmen aus der UK Biobank. Je schlechter der Schlafscore ausfiel, desto größer wurde die Lücke zwischen Hirn- und Kalenderalter: Personen mit insgesamt schlechter Schlafqualität zeigten ein Gehirnprofil, das ungefähr ein Jahr „älter“ wirkte als ihr tatsächliches Alter. Ein Teil dieses Zusammenhangs lässt sich durch eine niedriggradige Entzündung erklären.
Guter Schlaf als Hebel für Prävention
Schlaf ist ein grundlegendes Bedürfnis, das eine wesentliche Rolle bei einer Vielzahl biologischer Funktionen spielt: Darunter die Regulierung des Stoffwechsels, das Abwehrsystem wird ausbalanciert, das Gehirn räumt Abfallstoffe auf. Weiters werden Erinnerungen werden sortiert und gespeichert. Schlafstörungen treten im höheren Alter häufig auf, und es gibt zunehmend Hinweise auf einen komplexen Zusammenhang zwischen Schlaf und Demenz. Es ist allerdings unklar, ob Schlafstörungen zur Entwicklung von Demenz beitragen oder eher eine Folge des Frühstadiums sind.
In der Studie wurden fünf einfache Schlafmerkmale untersucht: Ob jemand morgens oder abends aktiver ist, ob sieben bis acht Stunden geschlafen wird, grundlegende Ein- und Durchschlafstörungen hat, nicht schnarcht und tagsüber nicht stark schläfrig ist. Aus diesen Angaben ergaben sich drei Gruppen: Gesunder, mittlerer oder schlechter Schlaf.
Warum ist das „Hirnalter“ relevant? Ein höheres „Hirnalter“ im Vergleich zum tatsächlichen Alter gilt als Frühwarnsignal für nachlassende Hirngesundheit. Weiters ist es mit einem erhöhten Risiko für kognitiven Abbau verknüpft. Schlaf ist zugleich veränderbar – damit wird er zu einem naheliegenden Hebel für Prävention im Alltag, bevor teurere oder belastendere Maßnahmen nötig werden.
Was lässt sich konkret zu Hause tun?
Vieles beginnt mit dem Umfeld und den Gewohnheiten. Abends hilft warmes, gedimmtes Licht; am Morgen stabilisieren Tageslicht oder ein kurzer Spaziergang den inneren Takt. Regelmäßige Routinen mit sieben bis acht Stunden Schlaf und konstanten Zeiten unterstützen den Körper. Eine ruhige, eher kühle Schlafumgebung um 18 bis 20 Grad und stolperfreie Wege – besonders Richtung Bad – reduzieren Störungen und Risiken. Im Abendprogramm lohnt es sich, Alkohol und Nikotin zu vermeiden und Bildschirme rechtzeitig zu dimmen. Wer laut schnarcht, Atemaussetzer bemerkt oder deutlich unter Ein- und Durchschlafproblemen leidet, sollte dies medizinisch abklären lassen.
Auch ein Blick auf Medikamente kann helfen: Anregende Mittel am Abend stören häufig den Schlaf, mögliche Wechselwirkungen gehören in der Apotheke oder ärztlichen Praxis abgeklärt.
Natürlich hat die Studie Grenzen: Die Schlafangaben stammen aus Selbstauskünften, und die UK Biobank umfasst tendenziell gesündere Menschen als der Durchschnitt. Kausalität lässt sich aus diesen Daten nicht endgültig ableiten. Zukünftige Studien sind notwendig, um festzustellen, ob eine Verbesserung der Schlafqualität die Gesundheit des Gehirns und die kognitiven Fähigkeiten verlängern kann.
Die Botschaft für den Alltag bleibt dennoch klar: Besserer Schlaf ist machbar – und könnte sich unmittelbar in einem „jüngeren“ Hirnprofil widerspiegeln. Für Familien und Pflegende heißt das: Die Verbesserung der Schlafqualität gehört auf die Agenda.
Quelle: Poor sleep health is associated with older brain age: the role of systemic inflammation
Author: Anja Herberth
Chefredakteurin