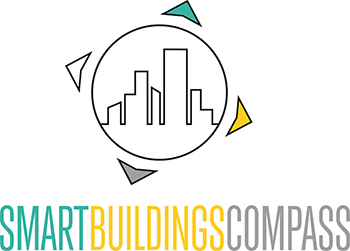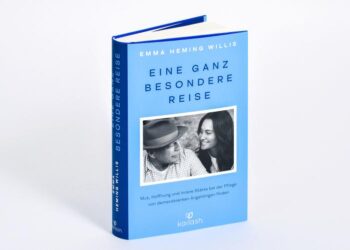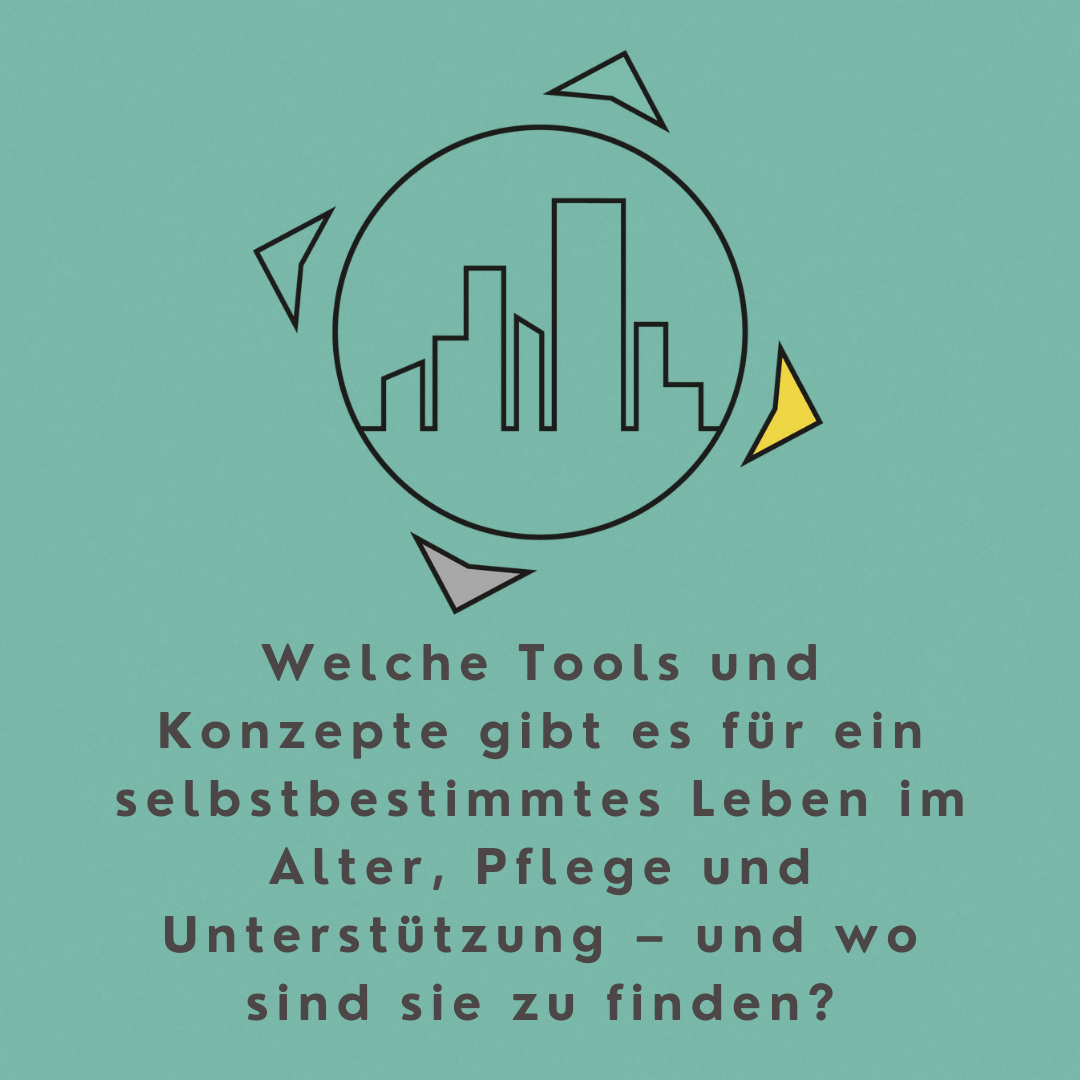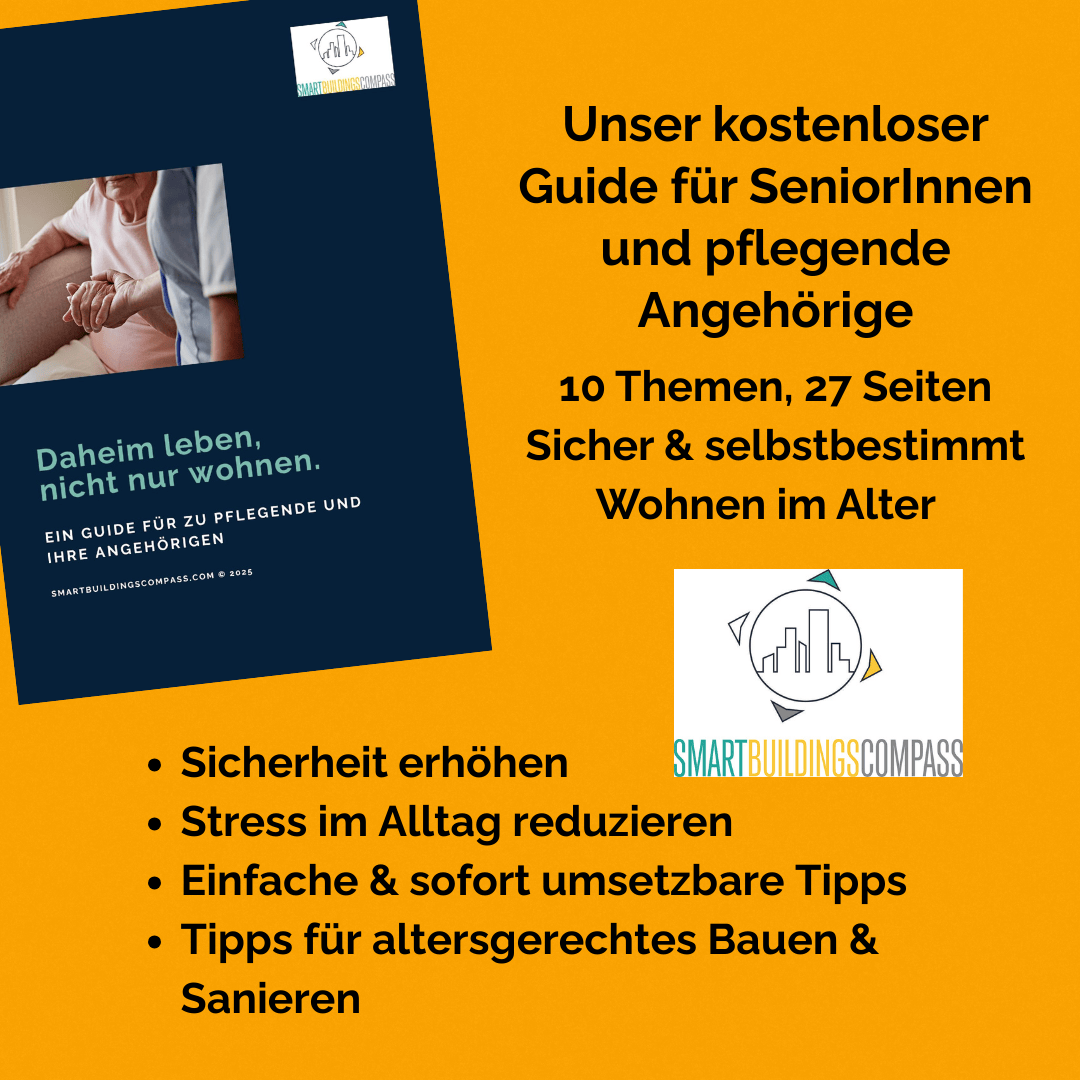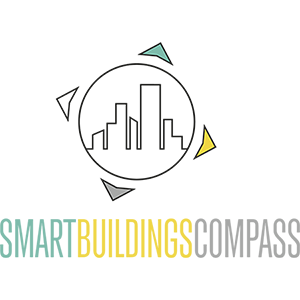This article is also available in:
English
Medizinisches Wissen ist heute leichter zugänglich als je zuvor – vom Schnelltest in der Apotheke über Online-Gesundheitsportale bis hin zu genetischen Analysen. Viele Menschen wollen bestimmte Informationen aber gar nicht erst wissen. Eine aktuelle Übersichtsarbeit des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin zeigt, wie verbreitet dieses Verhalten ist – und welche Folgen es haben kann.
Das Ergebnis: Die bewusste Entscheidung, „lieber nicht zu wissen“, ist kein Randphänomen, sondern betrifft Millionen Menschen weltweit. Die Meta-Analyse wertete 92 Studien und sechs Datensätze mit über 560.000 Teilnehmenden aus 25 Ländern aus. Ergebnis: Fast jede dritte Person (30 %) vermeidet oder verzögert aktiv medizinische Informationen. Besonders hoch ist die Quote bei Krankheiten, die bislang unheilbar sind, also Alzheimer, der Huntington-Krankheit, HIV, Krebs und Diabetes.
Während bei behandelbaren Erkrankungen wie Diabetes (24 %) die Vermeidung seltener ist, steigt sie deutlich, wenn es kaum oder keine Therapieoptionen gibt (Alzheimer: 41 %).
Warum Menschen nicht wissen wollen
Die Studie identifiziert 16 Einflussfaktoren, die erklären, warum Menschen medizinischen Informationen ausweichen. Die wichtigsten:
Stigmatisierung: Die Angst, von anderen verurteilt oder ausgegrenzt zu werden.
Informationsüberlastung: Zu viele, oft widersprüchliche Infos überfordern.
Geringes Vertrauen ins Gesundheitssystem: Wer Ärzten und Institutionen misstraut, will Ergebnisse eher nicht wissen.
Niedrige Selbstwirksamkeit: Menschen, die das Gefühl haben, ohnehin nichts ändern zu können, vermeiden Wissen.
Geschlecht, Alter oder Herkunft spielten hingegen kaum eine Rolle.
Wie die Pharmazeutische Zeitung berichtet, ist dieses Ausweichen keineswegs nur irrational. Kurzfristig kann es psychisch entlastend wirken, eine mögliche schlechte Nachricht nicht zu hören. Langfristig birgt es jedoch Risiken: Erkrankungen werden später erkannt, Therapien verzögert oder Präventionschancen vertan. Besonders problematisch wird es bei Krebs oder Demenz – dort entscheidet der Zeitpunkt einer Diagnose oft über den Verlauf.
Wie man sich vorbereiten kann
Die Angst vor einer schlimmen Diagnose ist verständlich. Doch Vorbereitung kann helfen, den Schock abzufedern und handlungsfähig zu bleiben. ExpertInnen empfehlen fünf Schritte:
Nicht allein hingehen
Eine vertraute Person zum Termin mitnehmen: Sie hört mit, kann Fragen stellen und hinterher helfen, das Gehörte zu sortieren. Das entlastet – und verhindert, dass wichtige Informationen in der Aufregung untergehen.Fragen und Sorgen notieren
Vor dem Arztbesuch eine Liste schreiben: Was möchte ich unbedingt wissen? Welche Ängste habe ich? So behalten Sie die Kontrolle – auch wenn die Situation emotional aufgeladen ist.Informationen dosieren
Ergebnisse müssen nicht in einem Gespräch „abgeladen“ werden. Es kann sinnvoll sein, Zwischenberichte oder Folgetermine zu vereinbaren. Kleine, verständliche Informationspakete helfen, Überforderung zu vermeiden.Unterstützung annehmen
Psychologische Beratung, Psychoonkologie (spezialisiertes Hilfsangebot für Menschen mit einer Krebserkrankung und deren Angehörige, um psychische und soziale Belastungen durch die Krankheit zu bewältigen) oder auch Selbsthilfegruppen bieten geschützte Räume, um über Ängste zu sprechen. Der Austausch mit Menschen, die ähnliches erlebt haben, wirkt entlastend und stärkt das Gefühl, nicht allein zu sein.Schon vorab Perspektiven kennen
Wer mögliche nächste Schritte kennt (Therapien, Pflegeoptionen, rechtliche Vorsorge), fühlt sich weniger ausgeliefert. Es geht nicht darum, Katastrophenszenarien zu durchspielen, sondern um Orientierung: „Wenn A, dann könnte B folgen.“
So wird aus der reinen Angst eine Haltung von Vorbereitung und Selbstwirksamkeit – und das Risiko, wichtige Informationen komplett auszublenden, sinkt.
Die Studie ist aus unserer Sicht eine wichtige Analyse, da es immer mehr ältere Menschen gibt. Dementsprechend sind Erkrankungen wie Alzheimer und Krebserkrankungen auf dem Vormarsch. Für die Versorgung älterer Menschen und chronisch Kranker bedeutet das: Es reicht nicht, Diagnosen verfügbar zu machen – sie müssen auch annehmbar sein.
Quellen:
Konstantin Offer et al. (2025): Prevalence and predictors of medical information avoidance: a systematic review and meta-analysis. Annals of Behavioral Medicine. Hier gehts zur Studie
Pharmazeutische Zeitung: Viele Menschen blenden Diagnosen aus (28.08.2025)
Author: Anja Herberth
Chefredakteurin