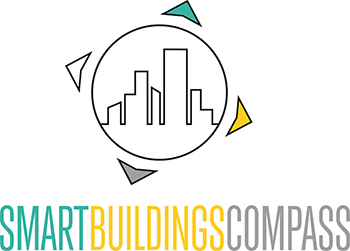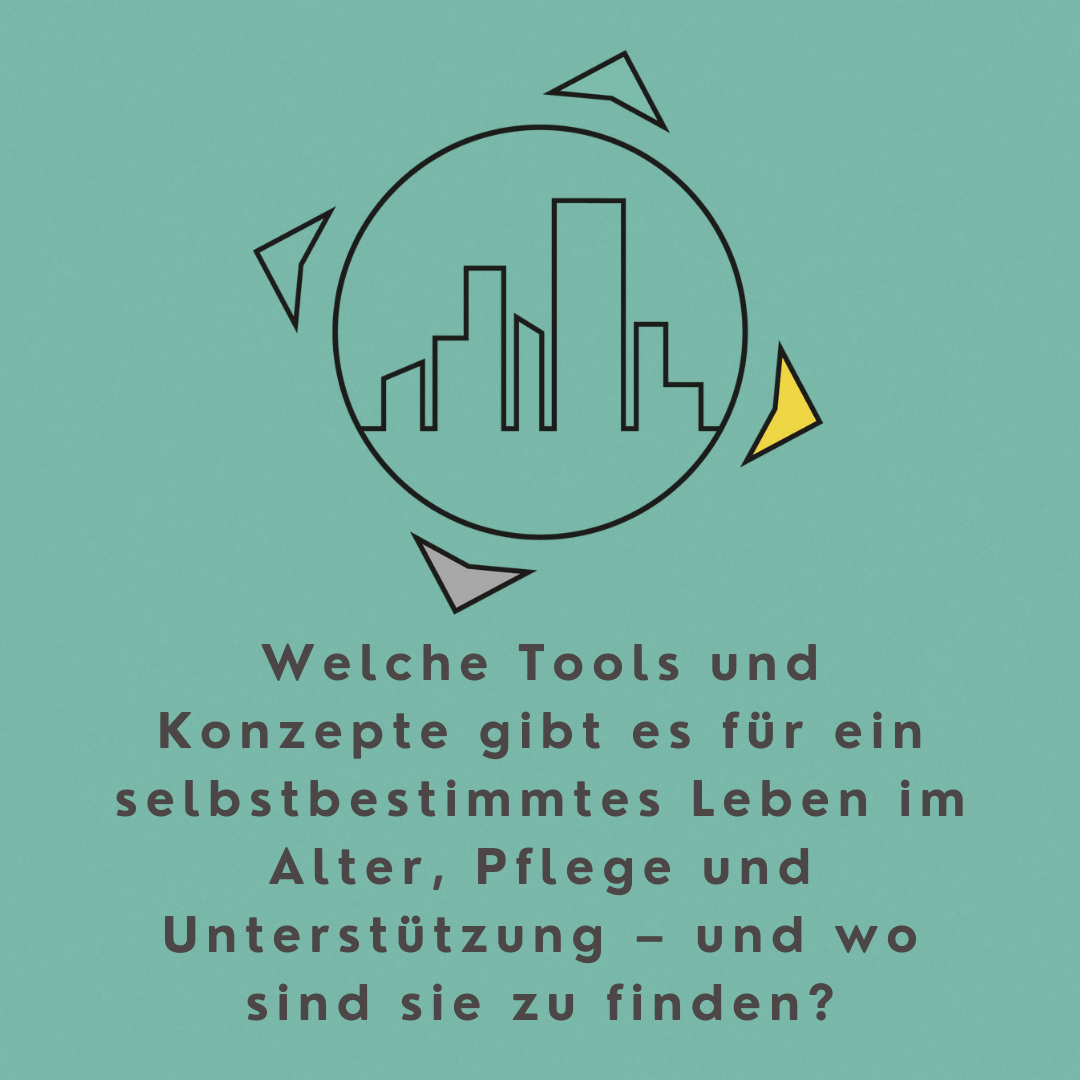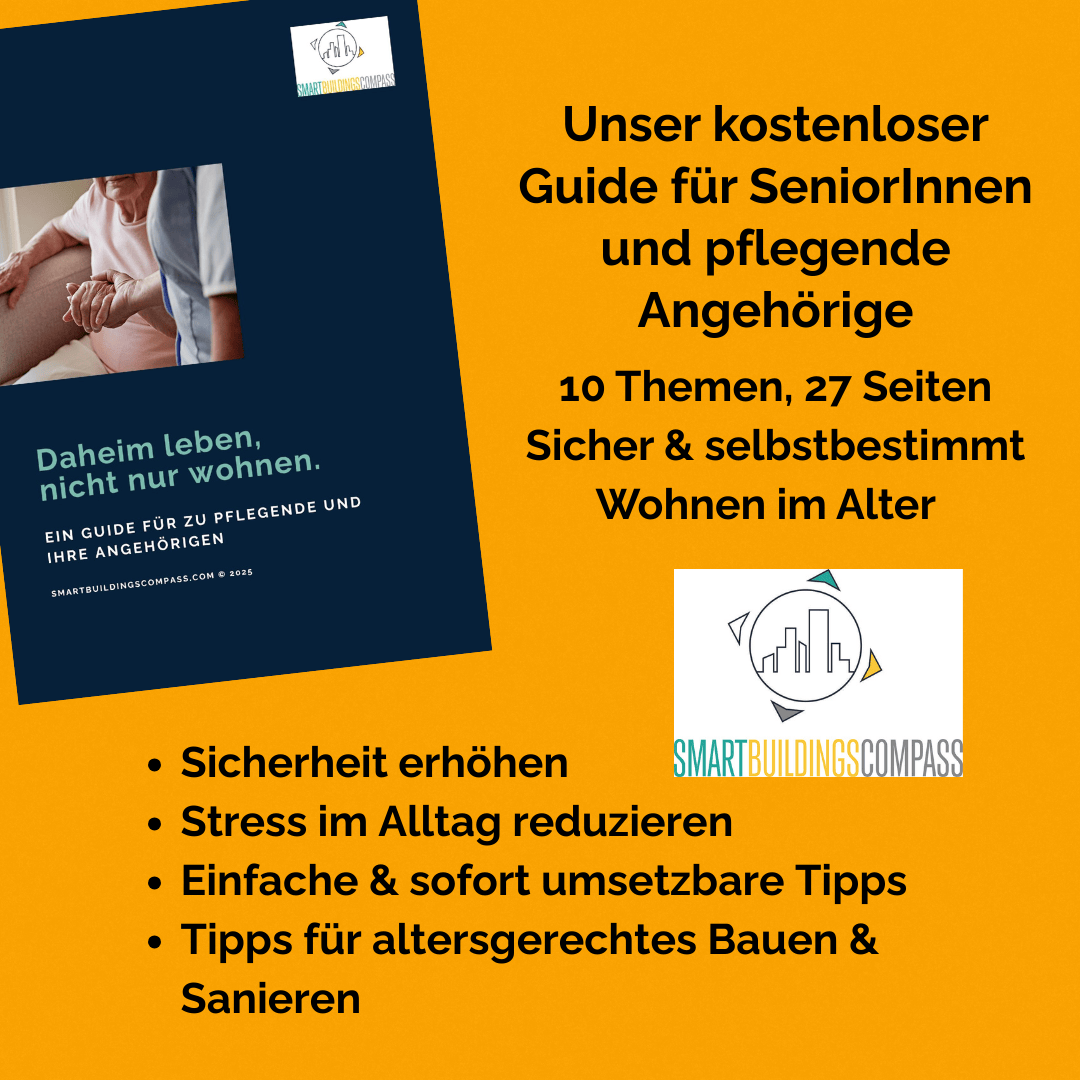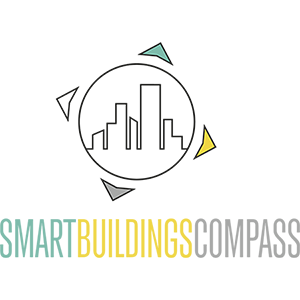This article is also available in:
English
Drei Jahre lang wurde in ganz Österreich das Konzept Community Nursing erprobt, welches ältere Menschen, chronisch Erkrankte und pflegende Angehörige frühzeitig begleiten und stabilisieren sollte. Eine Evaluation der FH Kärnten ist eindeutig positiv: Die Pilotphase hat gezeigt, wie groß der Bedarf an wohnortnaher Gesundheitsförderung und präventiver Unterstützung ist. Dennoch wurden und werden die Projekte nach dem Auslaufen der EU-Finanzierung Ende 2024 in einigen Bundesländern reduziert, umgebaut oder ganz eingestellt.
Im Gespräch mit der freiberuflichen Community Nurse Magdalena Fischill-Neudeck wird deutlich, was auf dem Spiel steht: Prävention lässt sich nicht in Legislaturperioden denken. Sie benötigt langfristige Strukturen, multiprofessionelle Zusammenarbeit und eine klare politische Entscheidung – Mut inklusive. Gleichzeitig zeigt das Interview, warum Community Nursing weit mehr ist als „zusätzliche Pflege“ – und welche Folgen der Rückbau für Gemeinden, Betroffene und das gesamte Versorgungssystem hat.
SBC: Was steckt hinter dem Begriff Community Nurses, was ist die grundlegende Idee dahinter?
Fischill-Neudeck: Community Nurse bzw. Community Health Nurse sind internationale Begriffe für Pflegepersonen, die in der gemeindenahen Vorsorge und Versorgung tätig sind. Bei uns in Thalgau, wo ich als Community Nurse aktiv bin, haben wir den Begriff Gesundheitspflege gewählt. Das beschreibt den Kern unserer Tätigkeit gut. Die Idee dahinter ist, die Gesundheitspflege dorthin zu bringen, wo Menschen leben: In die Gemeinde, in die Nachbarschaft, in die eigenen vier Wände.
Wir Community Nurses sind diplomierte Gesundheits- und KrankenpflegerInnen, die niederschwellig erreichbar sind und wohnortnah arbeiten. Wir besuchen Menschen zu Hause im Zuge von präventiven, also vorsorglichen Hausbesuchen. Wir unterstützen pflegende Angehörige vor Ort – etwa indem wir sie über Hilfsmittel, regionale Unterstützungsangebote oder Entlastungsmöglichkeiten informieren und im praktischen Tun anleiten. Es geht um Prävention, Orientierung und Unterstützung – nicht erst dann, wenn ein gesundheitlicher Notfall eintritt, sondern lange davor.
Wir zeigen Wege auf, wie man die eigene Gesundheit verbessert, stabilisiert oder mit gesundheitlichen Einschränkungen besser umgehen kann. Gleichzeitig stärken wir das soziale Netz vor Ort, vernetzen Gesundheits- und SozialanbieterInnen und schaffen Strukturen, in denen Menschen in der Lebensqualität und Gesundheitskompetenz gestärkt werden. Im Kern geht es darum, kleine Probleme früh zu erkennen und zu verhindern, dass sie größer werden.

SBC: Wer kann die Services der Community Nurses nutzen? Gibt es Kriterien dafür?
Fischill-Neudeck: Grundsätzlich stehen Community Nurses allen Menschen in der jeweiligen Region offen. Während der dreijährigen EU-Pilotierung gab es Zielgruppenkriterien: Beispielsweise einen Fokus auf Menschen über 75 Jahre und auf pflegende Angehörige. Viele Regionen haben diese Zielgruppen jedoch bewusst erweitert, um auf die regionalen Bedürfnisse speziell einzugehen.
In Thalgau haben wir von Anfang an einen breiten Zugang gewählt: Jede Person mit einem gesundheitlichen oder pflegerischen Anliegen konnte sich melden, ohne eine Pflegestufe oder einen nachgewiesenen Bedarf vorweisen zu müssen. Diese Prävention – also Unterstützung, bevor Einschränkungen entstehen oder sich verschärfen – ist ein zentraler Bestandteil des Konzeptes.
SBC: Die Community Nurses basierten auf einer EU-Förderung, nun fallen deren Auslaufen viele dieser Gesundheits- und KrankenpflegerInnen dem Sparstift zum Opfer und werden nicht in die regionalen oder Länderbudgets übernommen. Wenn Sie auf die aktuelle Situation blicken: Wo stehen wir gerade?
Fischill-Neudeck: Die EU stellte das Startbudget für die ersten drei Jahre – also von 2022 bis 2024 – bewusst als Anschubfinanzierung zur Verfügung, um das Community Nursing-Konzept zu testen und um bei erfolgreicher Umsetzung eine Weiterführung anzuregen. Das wussten die Gemeinden und Bundesländer auch von Beginn an.
Wir haben zum Abschluss der Pilotierung gesehen, dass die österreichweit 116 Projekte sehr erfolgreich waren: Die Evaluierungsergebnisse der FH Kärnten sowie der Endbericht der Gesundheit Österreich GmbH zeigen klar positive Ergebnisse. In den Ausgleichsverhandlungen zwischen Bund und Ländern für 2024-2028 wurde Community Nursing in den Pflegefond aufgenommen. Trotzdem reagieren die Bundesländer seit Ende 2024 sehr unterschiedlich.
Die Gründe dafür liegen in den stark unterschiedlichen Ausgangslagen der Pflegeversorgung in den Bundesländern. Genau hier hätte das Konzept seine Stärke entfalten können, denn international wird Community Nursing als flexibles Baukastensystem verstanden: Stadtteile und Gemeinden sollten jene Elemente übernehmen, die sie in der jeweiligen Region benötigen – etwa die präventive Ausrichtung und die niederschwellige, kontinuierliche Erreichbarkeit. Wichtig ist nur, dass die Grundpfeiler, die im Aufgaben- und Rollenprofil von Community Nursing beschrieben sind, erhalten bleiben.
Seit Anfang 2025 zeigen sich sehr unterschiedliche Entwicklungen: Niederösterreich finanziert das Modell bis Ende 2026 weiter, die Steiermark und Salzburg haben Förderungen für ein weiteres Jahr zugesagt, teilweise unter Einbindung der Gemeinden. Tirol hat nur eine einzelne Leistung in bestehende Strukturen integriert und das restliche Konzept beendet. Im Burgenland sollen Pflegestützpunkte entstehen, in denen Community Nurses angesiedelt werden. Kärnten kombinierte Community Nursing ab 2025 mit der Pflegenahversorgung. Vorarlberg sichert die Finanzierung für 2025 und plant eine mögliche Integration in die Hauskrankenpflege ab 2026. In Oberösterreich wurde die Entscheidung den Sozialhilfeverbänden überlassen – was zu stark reduzierten Angeboten führte. Wien verankerte Community Nurses in der Struktur von 1450 und koordiniert präventive Hausbesuche über diese Stelle.
Diese Vielfalt zeigt: Obwohl das Konzept nachweislich funktioniert, wurde und wird es je nach Bundesland sehr unterschiedlich umgesetzt – von einer Voll-Finanzierung bis Ende 2026 hin zu starken Reduktionen und strukturellen Umwidmungen.
SBC: Welche direkten Folgen haben die aktuellen Kürzungen für Gemeinden, Betroffene und ihre pflegenden Angehörigen sowie für PflegerInnen? Was bedeutet das für die Versorgung vor Ort – vor allem in ländlichen Gemeinden, in denen die medizinische Versorgung und mobilen Dienste sowieso knapp sind?
Fischill-Neudeck: Community Nursing ist keine Akutversorgung und kein Rettungsdienst. Und genau deshalb wird der Wegfall dieses Angebotes vermutlich nicht unmittelbar spürbar sein. Die Wirkung dieses Konzepts liegt vielmehr in der langfristigen Entwicklung. Alle bisherigen Untersuchungen zeigen, dass der Fokus auf Gesundheitsförderung, Prävention und die Stärkung der Menschen, damit sie mit ihren gesundheitlichen Einschränkungen selbstständig zurechtkommen, dazu beiträgt, Folgekosten und Folgeprobleme deutlich zu reduzieren.
Besonders in entlegenen Gemeinden mit geringer medizinischer und pflegerischer Infrastruktur, langen Wegen und wenigen Versorgungsangeboten würden Community Nurses langfristig eine spürbare Verbesserung bringen: Bessere Koordination, bessere Vernetzung und eine strukturierte Orientierung für Betroffene. Denn der demografische Trend ist eindeutig: Die Zahl älterer Menschen steigt, damit auch das Risiko für Pflegebedarf. Die Frage ist nicht, ob der Bedarf zunimmt, sondern wie stark – und wie gut gegengesteuert wird.
Vorsorgliche Entscheidungen und präventive Maßnahmen können langfristig gesundheitliche und pflegerische Eskalationen verhindern. Sie helfen, einen Pflegebedarf hinauszuzögern, Gesundheitsprobleme zu reduzieren und damit Krankenhausaufenthalte oder Heimeinweisungen zu vermeiden bzw. zu verzögern. Ohne diese präventiven Strukturen werden die ohnehin steigenden Folgekosten noch weiter ansteigen.
Schon jetzt sind die Kapazitäten der mobilen Betreuungs- und Pflege-Dienste extrem unterschiedlich ausgeprägt – etwa im Vergleich zwischen einer Stadt wie Wien und ländlichen Regionen, wie im Flachgau in Salzburg. Ohne Prävention wird diese Kluft weiter wachsen. Die Folge sind noch längere Wartezeiten, überlastete mobile Pflege-Dienste und eine Versorgung, die Menschen weniger treffsicher erreicht. Das belastet Betroffene selbst sowie ihre pflegenden Angehörigen – gesundheitlich, organisatorisch und emotional.
SBC: Die angesprochenen Kürzungen klingen seitens der Politik nicht besonders weitsichtig gedacht. Welche langfristigen, auch volkswirtschaftlichen Folgen erwarten Sie durch den teilweisen Wegfall der Community Nursing-Projekte?
Fischill-Neudeck: In der Diskussion um Community Nursing treffen zwei völlig unterschiedliche Zeithorizonte aufeinander. Die Politik denkt in Legislaturperioden, die naturgemäß begrenzt sind. Gesundheitsförderung, Prävention und Versorgung lassen sich ich jedoch nicht in vier- oder fünfjährigen Zeiträumen gestalten – sie erfordern eine langfristige Planung, sektorübergreifende Zusammenarbeit und einen gemeinsamen Schulterschluss.
Zudem treffen wir, bedingt durch die unterschiedlichen Zuständigkeiten und Finanzierungsströme, in Gesundheitsressort, Sozialressort und Sozialversicherung auf ein ausgeprägtes Silo-Denken. Das hat möglicherweise viele Jahre funktioniert, stößt aber angesichts der heutigen Komplexität und Ressourcenknappheit an seine Grenzen. Wenn jeder Sektor versucht, kostenintensive Leistungen auf einen anderen abzuwälzen, entsteht keine Versorgung, die sich an dem Bedarf der Menschen orientiert.
Für Betroffene spielt es letztlich keine Rolle, ob Leistungen über Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge finanziert werden. Aus pflegefachlicher Sicht ist es jedoch problematisch, wenn notwendige Maßnahmen verzögert oder gar nicht ergriffen werden und dadurch später größere gesundheitliche Belastungen entstehen.
Deshalb braucht es dringend ein Aufbrechen dieser Sektorgrenzen und eine gemeinsame Prozessgestaltung, die sich an den Lebens- und Versorgungsrealitäten der Menschen orientiert. Investitionen in Prävention setzen konkret und frühzeitig an und wirken langfristig. Diese Einschätzung wird auch international gestützt: Die OECD und multiprofessionelle ExpertInnengremien empfehlen seit Jahren, stärker in die wohnortnahe Vorsorge und Gesundheitsförderung zu investieren, weil es langfristig Kosten spart und Leid reduziert.
Daher denke ich, dass das Problem der politischen EntscheidungsträgerInnen nicht mangelndes Wissen ist, sondern eine andere Interessenslogik. Außerdem ist es schwierig, weil man salopp gesagt mit dem theoretischen Wegfall von Kosten kein Foto machen kann – das lässt sich politisch also nicht gut ‚verkaufen‘. Vorsorge ist schwer messbar, weil es nicht unmittelbar Geld spart, sondern erst in der Zukunft.
Aus meiner Sicht sollten sich politische VertreterInnen stärker an ihre Rolle erinnern: Sie vertreten die Bevölkerung, deren Bedarfe sie ernst nehmen sollten. Dazu gehört auch, die Expertise jener einzubeziehen, die konkrete Vorschläge für eine zukunftssichere Versorgung machen. Systeme müssen weiterentwickelt werden, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Dafür braucht es Mut und Veränderungsbereitschaft – und genau das muss nun stärker eingefordert werden.
SBC: Wenn Sie nach vorne schauen: Was braucht es aus Ihrer Sicht jetzt? Welche politischen und gesellschaftlichen Schritte wären notwendig, um die Pflege – und insbesondere die Unterstützung in den Regionen – zukunftssicher aufzustellen?
Fischill-Neudeck: Wenn Menschen an Pflege denken, entstehen häufig stereotype Bilder: Eine Pflegerin, meist weiblich, am Bett einer hilfsbedürftigen Person, verbunden mit Verrichtungen und körpernahen Tätigkeiten. Diese Vorstellung mag in manchen Situationen korrekt sein, aber dieses Bild greift zu kurz. Gesundheits- und Krankenpflege ist weit mehr als die Summe einzelner Handgriffe. Sie umfasst eine ganzheitliche, fachliche Betrachtung, die darauf abzielt, Menschen zu befähigen, ihre Situation möglichst selbstständig zu bewältigen – oder dies mit gezielter Anleitung zu lernen.
Genau diese verengte Vorstellung verstellt den Blick auf das eigentliche Potenzial von Vorsorge und Ressourcenorientierung: Frühzeitig anzusetzen, bevor die gesundheitlichen Probleme eskalieren, und Menschen in ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken. Dazu gehört auch ein Perspektivenwechsel: Weg von einer reinen ‚Reparaturmentalität‘ hin zu einer vorsorglichen, ganzheitlichen Gesundheitspflege, an der nicht nur professionelle Dienste beteiligt sind. Sondern für die auch gesundheitsförderliche Verhältnisse etabliert sein müssen und jede und jeder selbst einen Beitrag leisten kann.
Auf Ebene der Gesundheits- und Pflegepolitik muss Gesundheit zu einem multiprofessionellen Thema werden, in dem die unterschiedlichen Berufsgruppen zusammenarbeiten. Und diese Zusammenarbeit müsste viel stärker als gemeinsames Projekt verstanden werden, das auch die Bevölkerung einbezieht. Auch die Kommunikation mit der Bevölkerung spielt eine entscheidende Rolle. Das sieht man auch in den aktuellen Debatten über Spitalschließungen oder Bettenkürzungen. Hier haben die Medien eine wichtige Rolle hinsichtlich einer umfassenden Informationsvermittlung, die Zusammenhänge nachvollziehbar klarstellt.
Vielen Dank für das Interview!
Unsere Interviewpartnerin Magdalena Fischill-Neudeck ist freiberufliche Gesundheits- und Krankenpflegerin und als Community Nurse in Thalgau tätig. Mehr Informationen finden Sie unter www.mehrgesundezeit.at
Author: Anja Herberth
Chefredakteurin