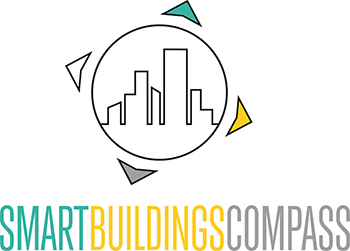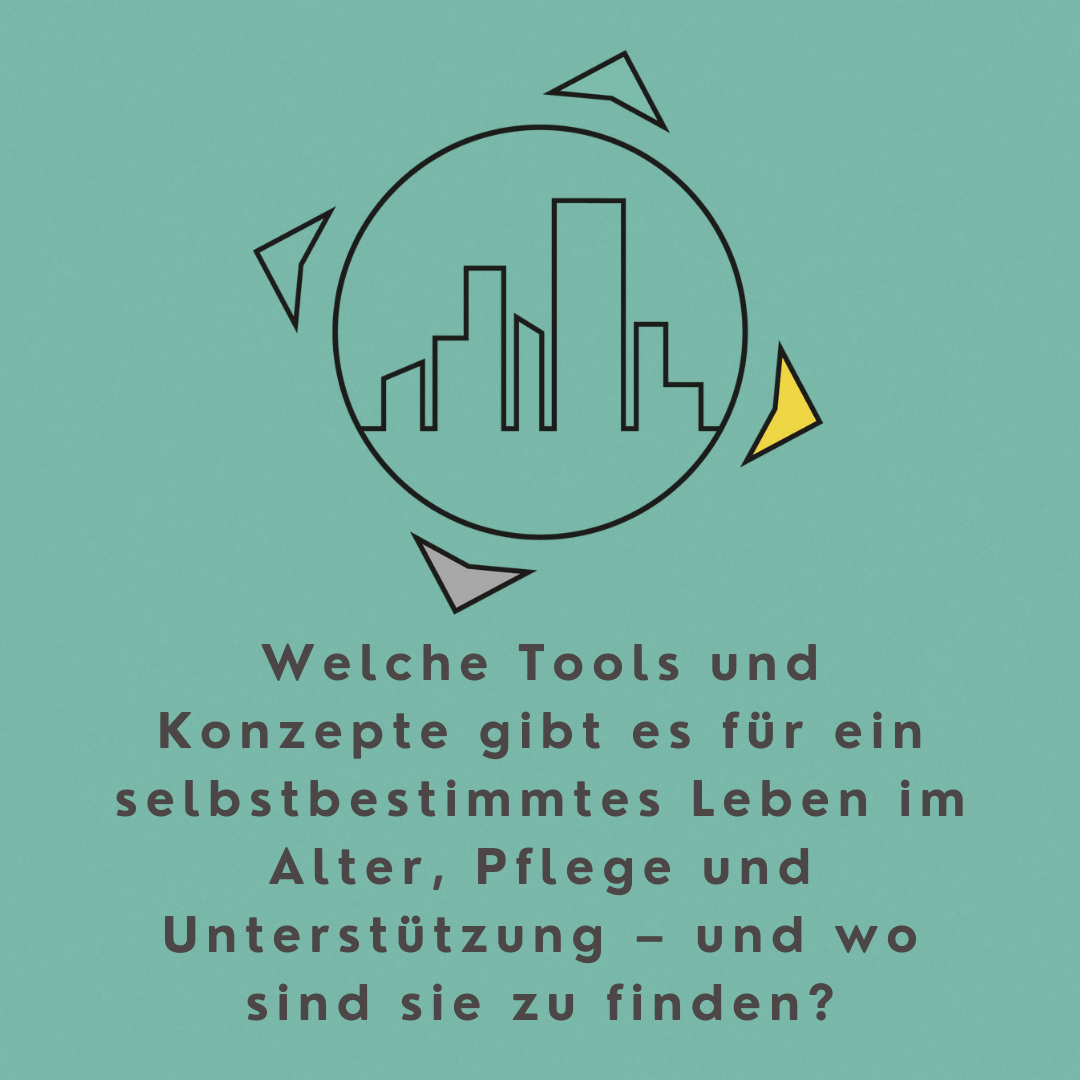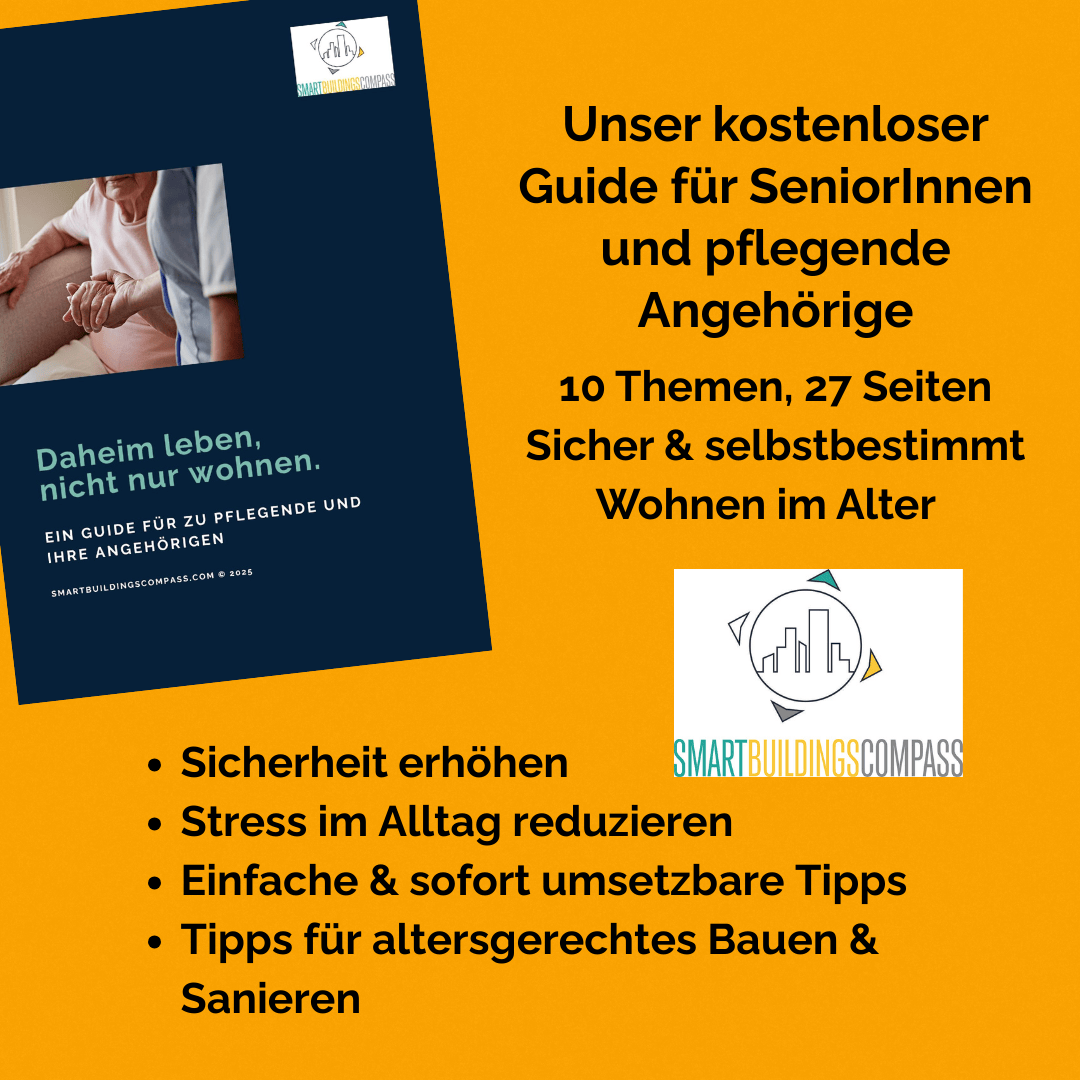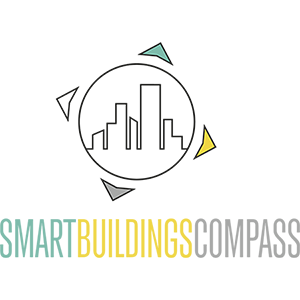Unser Interviewpartner Christian Gamsler ist stellvertretender Katastrophenschutzbeauftragter der Kärntner Landesregierung. Der Milizoffizier spricht mit uns darüber, warum öffentliche und private Vorsorgestrukturen in den vergangenen Jahrzehnten schrittweise zurückgefahren wurden – und mit welchen „Leuchtturm“-Projekten Kärnten nun gezielt gegensteuert. Außerdem erklärt er, warum die Datenschutzgrundverordnung eine belastbare Übersicht über pflege- und betreuungsbedürftige Menschen in der Praxis erheblich erschwert.
SBC: Der Berliner Blackout Anfang Januar: Wie bewerten Sie als Experte die Lage und welche Learnings sollten wir daraus ziehen?
Gamsler: Zunächst möchte ich gerne präzisieren: Es war ein Stromausfall – kein Blackout. Der Begriff `Blackout` wird im Alltag sehr schnell verwendet, aber fachlich meint er etwas anderes. Ein Blackout ist nach gängiger Definition ein großflächiger, überregionaler Stromausfall – teilweise länderübergreifend, im Extremfall mit Auswirkungen bis in weite Teile Europas. Das war hier nicht der Fall.
Was passiert ist: Ein regional begrenzter Stromausfall, ausgelöst durch einen gezielten, terroristischen Angriff mit entsprechend massiven Folgen für die betroffene Region. Aber ein Blackout sieht anders aus. Ich sage das nicht, um zu relativieren, ganz im Gegenteil: Die Auswirkungen eines regionalen Ausfalls können für die betroffenen Haushalte dramatisch sein. Nur sollten wir die Begriffe sauber verwenden, weil sie unterschiedliche Szenarien und damit auch unterschiedliche Vorsorgemaßnahmen beschreiben.
Und vielleicht ist genau das ein Learning: Viele nennen schon dann `Blackout`, wenn im Ort das Umspannwerk ausfällt. Fachlich betrachtet ist das nur ein Stromausfall – aber er zeigt, wie abhängig wir von funktionierender Infrastruktur sind.
>> Fachlich betrachtet ist das nur ein Stromausfall – aber er zeigt, wie abhängig wir von funktionierender Infrastruktur sind. <<
In Kärnten haben wir uns deshalb schon 2016 – gemeinsam mit der Katastrophenschutzabteilung und weiteren Organisationen – sehr bewusst an einen Tisch gesetzt und uns eine ehrliche Frage gestellt: Sind wir bei einem längerfristigen Stromausfall überhaupt in der Lage zu helfen – oder brauchen wir selbst Hilfe? Die Antwort war ernüchternd: Wir haben erkannt, dass wir in vielen Bereichen nicht so aufgestellt sind, wie wir es gerne hätten. In den letzten 30 bis 40 Jahren, in denen es uns in Europa vergleichsweise gut ging, sind öffentliche und private Vorsorgestrukturen zunehmend zurückgefahren worden, weil man sie schlicht für nicht mehr notwendig gehalten hat. Es gab keine großen Krisen, keine Kriege.
Dieses Muster sehe ich nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und anderswo. Und das ist auch der Punkt, an dem sich das Risikobild verändert hat: Wer Ressourcen lange auslagert oder abbaut, merkt erst in der Krise, was fehlt. Ein konkretes Beispiel: In Kärnten wurde der verpflichtende Schutzraumbau als Vorgabe in der Bauordnung bereits 1997 als letztes Bundesland herausgenommen. Schutzräume sind seither nicht mehr vorgeschrieben. Wenn uns heute jemand fragt, wie viele Schutzräume es in Österreich gibt, muss man ehrlich sagen: Es wird sicher noch Altbestände geben. Aber eine flächendeckend vorgesehene und systematisch vorgehaltene Schutzraum-Infrastruktur gibt es nicht mehr. Das zeigt sehr deutlich, wie sehr sich Prioritäten über Jahrzehnte verschoben haben.
SBC: Welche Krisenlage sehen sie aktuell für ein Bundesland wie Kärnten?
Gamsler: Wenn ich zurückblicke: 2016 war für viele von uns so ein Aha-Moment. Wir haben damals festgestellt, dass über Jahre hinweg quer durch die Strukturen viele Bereiche stillschweigend ausgelagert oder abgebaut wurden. Dinge, die früher selbstverständlich waren, sind mit der Zeit – so dachte man – unnötig geworden. Und ehrlich gesagt: Lange hat kaum jemand darüber gesprochen. Das Thema gab es einfach nicht.
Dann kamen Ereignisse, die das Bild verändert haben: Die Covid-Pandemie, punktuelle Stromabschaltungen und wiederkehrende Diskussionen um die Stabilität der Versorgung in bestimmten Winterphasen. Plötzlich wurde sichtbar: Ein Energiesystem ist nicht nur eine Frage von Spitzenleistung, sondern von Dauerlast. Die Erneuerbaren liefern stark – aber eben abhängig von Wind, Sonne und Wasser. Wenn mehrere Faktoren gleichzeitig schwach sind, braucht es Quellen, die verlässlich einspringen können. Und genau diese Debatten wurden in den letzten Jahren sehr real.
Was mich dabei immer wieder überrascht: Viele dieser Informationen sind öffentlich zugänglich – nur kaum jemand schaut hin. Ein gutes Beispiel ist der APG Power Monitor: Dort kann jede Person nachvollziehen, wie die Lage im Stromsystem gerade ist, woher der Strom kommt und wann das System besonders belastet ist. Und ja: Es gibt Phasen, in denen klar kommuniziert wird, dass das System stark beansprucht ist und dass Lastverschiebung hilft. Also Strom erst dann wieder verstärkt genutzt werden sollte, wenn weniger Last am Netz ist. Das sind keine Geheimnisse, nur dringt es im Alltag selten durch.
Und genau deshalb haben wir begonnen, das Thema sukzessive stärker zu bespielen: Nicht als Panikmache, sondern als Realismus und um die Handlungsfähigkeit zu verbessern.
Und vielleicht ist das mein wichtigster Punkt: Ich habe keine Angst vor dem großen Schreckensszenario, dass Menschen in einem Stromausfall verhungern oder verdursten. Was mir mehr Sorgen macht, ist etwas Bodenständigeres: Dass wir uns zu lange auf `das wird schon´ verlassen haben – und dabei übersehen, wie schnell Systeme an Grenzen kommen können, wenn viele kleine Faktoren zusammenfallen. Resilienz heißt, das nüchtern zu sehen – und daraus praktische Konsequenzen zu ziehen.
SBC: Was bedeutet der Satz „wir brauchen selbst Hilfe“ in einer Krise? Was bedeutet das für ein Bundesland wie Kärnten.
Gamsler: Mein Vorgesetzter hat sich stark in das Gesundheitsthema hineingearbeitet. Und genau deshalb haben wir uns 2019 bewusst zwei Blackout-Übungen in Kärnten vorgenommen. Wir haben das als Planspiel durchgespielt – unter anderem gemeinsam mit dem Bezirk Klagenfurt-Land. Ich selbst komme aus Ferlach, und dort gibt es ein Bezirksaltenwohnheim. Im Szenario haben wir angenommen: Es gibt keine Notstromversorgung – wir müssen 20 Pflegebetten evakuieren.
Wir sind im Zuge dieser Übung daraufgekommen, dass es in ganz Kärnten nicht einmal die Transportkapazität gibt, um 20 Personen aus Pflegebetten so zu verlegen, wie es medizinisch und organisatorisch korrekt wäre. Diese Kapazitäten sind schlicht nicht vorhanden. Und in dem Moment war klar: Wir haben ein echtes Thema.
Noch deutlicher wurde es, als im Planspiel die Reflexe eingesetzt haben: ÄrztInnen und Einrichtungen sagten sinngemäß: `Dann bringen wir alle ins Klinikum Klagenfurt.´ Gleichzeitig sagte das Klinikum: `Alle, die wir nicht zwingend im Haus brauchen, schicken wir nach Hause.´ Plötzlich hatten wir im Planspiel ein völlig absurdes Bild – der schlimmste Ort war die Kreuzung beim Klinikum, weil dort gleichzeitig viele Menschen rein- und rausströmten. Da merkt man sehr schnell: `Blackout = alle ins Krankenhaus´ funktioniert nicht.
Und damit sind wir beim Kern: Bei einem echten Blackout – also einem großflächigen, länger andauernden Ausfall – kann man nicht davon ausgehen, dass Hilfe von außen kommt. Wenn ein ganzes Bundesland betroffen ist, dann brauchen alle Bezirke ihre eigenen Stromaggregate, ihre eigenen Ressourcen, ihre eigenen Kräfte. Jede Organisation, jede Firma, jede Einrichtung greift zuerst auf das zurück, was sie selbst hat. Bedeutet: Man muss vor Ort handlungsfähig bleiben – weil niemand von außen schnell einspringen kann.
>> Man muss vor Ort handlungsfähig bleiben – weil niemand von außen schnell einspringen kann. <<
Genau deshalb ist Berlin für mich auch ein wichtiger Vergleich: Dort war eine Region betroffen, aber es konnten Kräfte und Unterstützung aus nicht betroffenen Bereichen nachgezogen werden. Bei einem großflächigen Ausfall sieht die Logik völlig anders aus – und genau deshalb unterscheiden wir so strikt zwischen regionalem Stromausfall und Blackout: Nicht, weil das eine harmlos wäre, sondern weil die Einsatz- und Versorgungspläne komplett andere sind.
Und noch ein Punkt, der gern übersehen wird: Am Ende hängt sehr viel an der kommunalen Ebene. BürgermeisterInnen und Gemeinden sind im Ernstfall die erste Verantwortungslinie – mit allen Konsequenzen. Darüber greifen Bezirk und Land unterstützend ein, aber immer unter einer Prämisse: Eigenverantwortung fällt nicht weg.

SBC: Was mir im Zuge der Interviews aufgefallen ist: Die Regionen sind sehr unterschiedlich auf Krisen vorbereitet. Kärnten gilt als Bundesland mit vielen Kriseneinsätzen: Im Sommer gibt es Hochwasser, im Winter sehr viel Schnee. Es gibt sehr viel Krisenpraxis. Als wir in Wien-Umgebung 2024 vom Hochwasser betroffen waren, waren wir völlig unvorbereitet.
Gamsler: Wir ticken da ein bisschen anders. Wenn es im Kärntner Gailtal einen halben Meter schneit, geht dort die Welt nicht unter. Der Gailtaler ist entspannt und freut sich, weil super Schnee für die Schneegebiete.
>> Ich habe einen Merksatz: In der Krise zählen die drei `Ks: In der Krise Köpfe kennen. <<
Ich habe einen Merksatz: In der Krise zählen die drei `Ks: In der Krise Köpfe kennen. Oder etwas salopper gesagt: In der Krise zählt, dass man die richtigen Menschen kennt – und zwar bevor es ernst wird. Weil dann nicht mehr die perfekte Checkliste entscheidet, sondern ob man schnell an die richtigen AnsprechpartnerInnen kommt und Wege kurz hält. Wichtig ist dabei auch die Zuständigkeit: Katastrophenschutz ist in Österreich primär Ländersache, nicht Bundessache. Es gibt nur wenige echte `Bundeskatastrophen´ – etwa eine Pandemie, Tierseuchen oder Themen des Strahlenschutzes. Ein großflächiger Blackout könnte in diese Dimension fallen, aber gerade dann wäre auch klar: Koordinieren allein reicht nicht, weil niemand von außen so schnell helfen kann.
Genau deshalb sind wir zu einem Umdenken gekommen: Das Verschieben von Verantwortung funktioniert in der Krise nicht. Wenn Ampeln ausfallen, Straßen blockiert sind und Infrastruktur wackelt, kommt Hilfe nicht automatisch dort an, wo sie gebraucht wird. Also muss die Resilienz vor Ort steigen.
Konkret haben wir in Kärnten deshalb einen Schwerpunkt auf Pflege- und Betreuungseinrichtungen gelegt. Wir haben gemeinsam mit BetreiberInnen, Gemeinden und privaten Trägern eine Initiative gestartet, um die Notstromversorgung in stationären Einrichtungen deutlich zu verbessern. Kärnten hat rund 78 Altenwohn- und Pflegeeinrichtungen; dort ist die Abdeckung mit stationären Notstromlösungen inzwischen nahezu flächendeckend.
Zusätzlich wurde die Kärntner Bauordnung angepasst: Bei Neubauten und größeren Umbauten von Pflege- und Betreuungseinrichtungen ist eine Notstromversorgung verpflichtend – zumindest in dem Sinn, dass die technischen Anschlüsse vorbereitet sein müssen. Das muss nicht immer ein fix installiertes Aggregat sein, aber die Infrastruktur muss so ausgelegt sein, dass ein Notstromaggregat sicher angeschlossen werden kann.
Über unseren Landesrat Ing. Daniel Fellner haben wir gemeinsam mit den Kärntner Gemeinden die Aktion „Leuchtturm“ umgesetzt. Und das ist aktuell ein Bereich, in dem sich sehr viel positiv entwickelt – die Aktion läuft ja noch. Stand jetzt haben wir 152 Leuchttürme in allen 132 Kärntner Gemeinden. Das ist nicht nur ein Konzept auf Papier: Man kann diese Standorte sogar online nachvollziehen – über die Katastrophenschutzkarte im Kärntner KAGIS, dem georeferenzierten System des Landes.
>> Stand jetzt haben wir 152 Leuchttürme in allen 132 Kärntner Gemeinden. Das ist nicht nur ein Konzept auf Papier: Man kann diese Standorte sogar online nachvollziehen – über die Katastrophenschutzkarte im Kärntner KAGIS, dem georeferenzierten System des Landes. <<
Die Idee dahinter ist einfach: Das Land hat die Gemeinden finanziell dabei unterstützt, mobile Notstromaggregate anzuschaffen – und zwar gezielt dort, wo im Ernstfall ein echter Anlaufpunkt entstehen kann. Die Gemeinden haben dafür geeignete Einrichtungen gemeldet: Zum Beispiel Gemeindehäuser, Schulen oder Kultureinrichtungen, die eine Küche haben und barrierefrei sind, WCs und idealerweise auch Duschmöglichkeiten bieten. Für diese Standorte wurde ein großer Teil der Kosten für die mobilen Aggregate gefördert – und so ist dieses Leuchtturm-Netz entstanden.
Warum mobil? Wegen der Flexibilität. Stationäre Anlagen sind fix gebunden, wo sie installiert sind. Mobile Aggregate können hingegen dorthin gebracht werden, wo sie gebraucht werden. Und das macht in der Praxis einen riesigen Unterschied: Wenn es einer Gemeinde gut geht und einer Nachbargemeinde schlecht, kann man unterstützen – mit stationären Lösungen ist das fast unmöglich. Das war der Kern des Konzepts, und es funktioniert.
SBC: Rund 80 % der pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause versorgt. Wie werden pflegende Angehörige in der Krisenvorsorge konkret mitgedacht und eingebunden – gibt es dafür bereits Strukturen oder Konzepte?
Gamsler: Das ist eine ganz zentrale Frage. Und ja: Genau an diesem Punkt sind wir sehr deutlich an Grenzen gestoßen. Wir haben das Problem früh erkannt und es ist uns in Übungen und Gesprächen immer wieder klar geworden: Es gibt keine verlässliche, datenschutzkonforme Gesamtübersicht, wo sich pflege- und betreuungsbedürftige Menschen befinden und wer im Ernstfall besonders vulnerabel ist. Wir haben versucht, uns an verschiedene Stellen anzudocken – etwa über Krankenkassenstrukturen –, aber die Daten liegen in unterschiedlichen Formen vor, sind nicht zentral zusammengeführt und sind aufgrund der Datenschutzlage nicht einfach nutzbar. Kurz gesagt: Wir sind an der Datenschutzkonstellation gescheitert.
>>Es gibt keine verlässliche, datenschutzkonforme Gesamtübersicht, wo sich pflege- und betreuungsbedürftige Menschen befinden und wer im Ernstfall besonders vulnerabel ist.<<
Ein Beispiel, das die Dimension greifbar macht: Mein damaliger Vorgesetzter hat sich in dieses Thema eingearbeitet und österreichweit herumtelefoniert. Dabei ist er auf eine Zahl gestoßen, die viele unterschätzen: In Kärnten gibt es rund 3.000 Personen mit Heimbeatmungsgeräten. Und damit wird sofort klar, worüber wir reden: Diese Geräte sind nicht „nice to have“. Für Krisen haben diese Haushalte Reserveakkus zu Hause, aber bei einem länger andauernden Stromausfall wird das schnell existenziell.
Deshalb arbeiten wir mit einem Zeithorizont von 72 Stunden. Diese gelten im Katastrophenschutz als eine Art Grenze dessen, was man noch halbwegs strukturiert bewältigen kann. Danach wird es sehr schwer, Ordnung und Versorgung stabil zu halten. Warum genau 72 Stunden? Unter anderem, weil die Stromwirtschaft – zumindest für klassische technische Störungen – häufig davon ausgeht, innerhalb von 24 Stunden wieder eine Versorgung aufbauen zu können. Aber das ist eben nur dann realistisch, wenn es sich nicht um gezielte Angriffe auf Infrastruktur handelt. Ein Anschlag wie in Berlin verändert die Spielregeln.
Gleichzeitig muss man unterscheiden: Regional begrenzte Ausfälle sind anders handhabbar, weil Unterstützung aus nicht betroffenen Regionen nachgezogen werden kann. Ein Blackout im eigentlichen Sinn – also großflächig, mehrere Regionen gleichzeitig – ist eine andere Lage: Dann sind alle im selben Boot, Ressourcen sind überall knapp, und Hilfe von außen kommt nicht in der Geschwindigkeit, die man sich wünschen würde.
Und genau deshalb ist die Frage nach pflegenden Angehörigen so brisant: Wir wissen, dass sie den größten Teil der Versorgung tragen – aber wir haben nicht automatisch eine belastbare Struktur, um diese Haushalte im Ernstfall gezielt zu erreichen und zu unterstützen. Das ist eine reale Lücke, die wir benennen müssen, wenn wir Resilienz ernst meinen.
SBC: Was raten Sie pflegenden Angehörigen: Was ist der wichtigste Punkt, den sie für eine Krise vorbereitet haben sollten?
Gamsler: Das größte Risiko für Einzelpersonen liegt bei Medikamenten und vor allem Spezialmedikamenten. Weil bestimmte Medikamente, die Menschen dringend brauchen, in der Krise nicht auf Vorrat bereitliegen oder auch rasch irgendwo abzuholen sind. Wenn Verkehr, Kommunikation und Logistik gleichzeitig wackeln, ist das einfach nicht möglich.
Genau deshalb ist das im Gesundheitsbereich aus meiner Sicht eine der gefährlichsten Lücken: Das, was jemand individuell braucht, ist oft genau das, was nicht lagerbar, nicht austauschbar und nicht kurzfristig beschaffbar ist. Und als pflegende Angehörige ist man davon genauso betroffen: Man geht im Chaos ja mit unter, wenn plötzlich vieles gleichzeitig nicht mehr funktioniert.
>> Das, was jemand individuell braucht, ist oft genau das, was nicht lagerbar, nicht austauschbar und nicht kurzfristig beschaffbar ist. <<
Ein zweiter blinder Fleck, den wir immer wieder sehen: Mobile Pflege und Betreuung im Krisenmodus. Viele Abläufe hängen heute am Handy: Touren, Dokumentation, Kontakte. Ein Smartphone funktioniert im Ausfall nicht verlässlich. In der Praxis heißt das: Es braucht Ausdrucke, klare Papier-Backups, einfache Routinen. Sonst weiß niemand mehr, wer wohin muss, wer welche Medikamente braucht, wer priorisiert wird.
Und ja – das Frustrierende ist: Solange nichts passiert, macht kaum jemand etwas zur Vorsorge. Das betrifft nicht nur BürgerInnen, sondern auch Organisationen. Erst wenn es einmal wirklich weh getan hat, steigt die Bereitschaft, sich vorzubereiten. Aber selbst dann wird oft zu wenig konsequent nachgezogen. Prävention ist eben unbequem, solange der Nutzen nicht unmittelbar spürbar ist.
Wir versuchen daher, an den Stellen anzusetzen, die realistisch sind: Zum Beispiel mit Lösungen, die im Alltag funktionieren – und mit Absprachen, die im Ernstfall nicht von digitaler Infrastruktur abhängen. Es gibt auch konkrete Schritte in Zusammenarbeit mit Standesvertretungen – ÄrztInnen, Apotheken – um zumindest die Basisversorgung praktikabler zu machen. Aber auch da muss man ehrlich sein: Das funktioniert in Haushaltsmengen, nicht als Vollversorgung in einer länger andauernden Krise.
Und das ist vielleicht der wichtigste Satz dazu: Man wird nie `fertig´ sein. Je tiefer man einsteigt, desto mehr entdeckt man. Aber genau deshalb lohnt sich jeder Schritt, der die Handlungsfähigkeit erhöht – gerade für jene Menschen, die auf Medikamente, Pflege und stabile Routinen angewiesen sind.
Vielen Dank für das Interview!
Hier geht’s entlang:
Author: Anja Herberth
Chefredakteurin