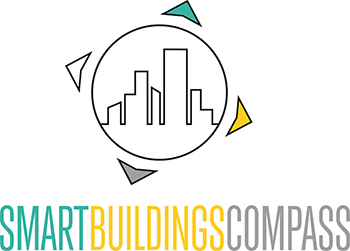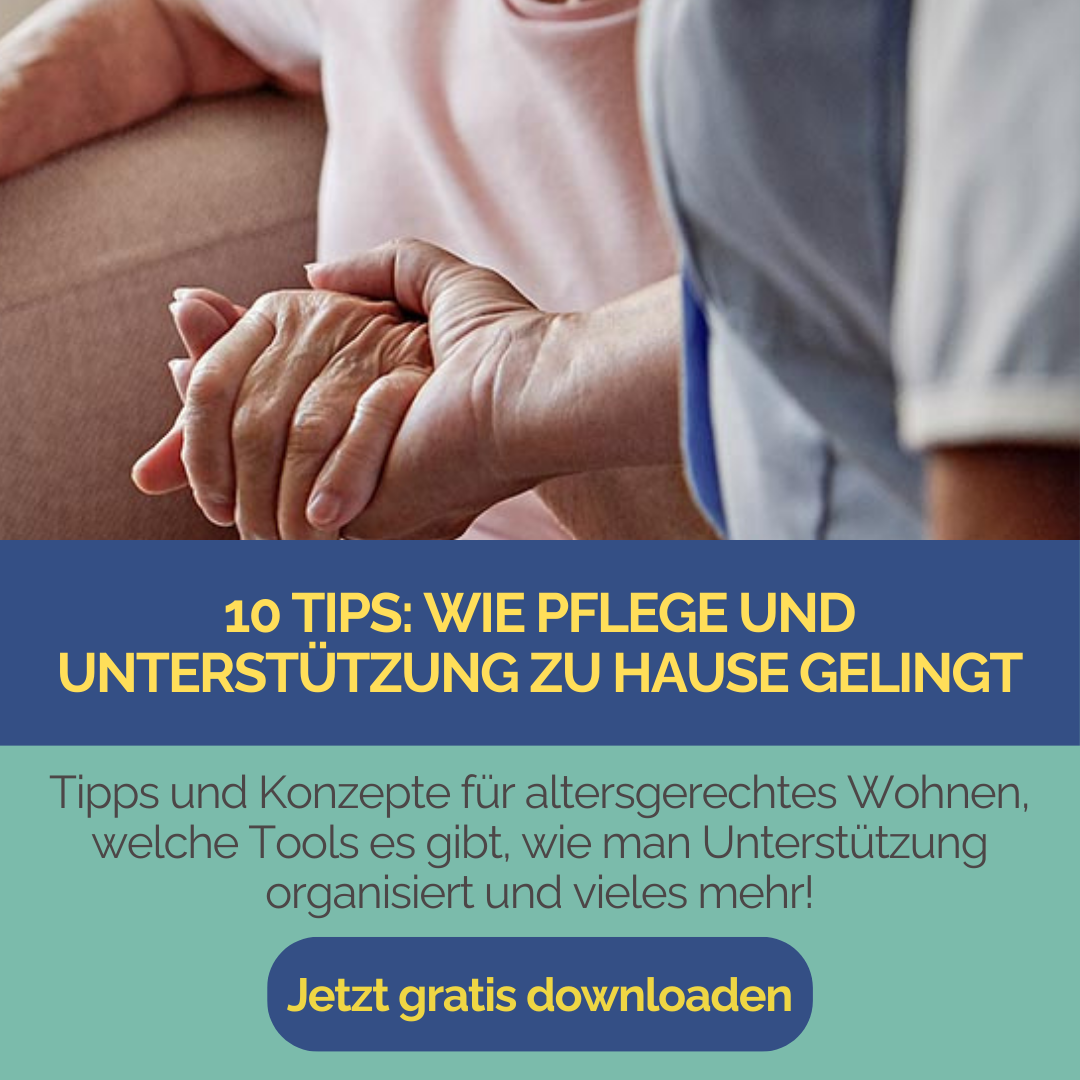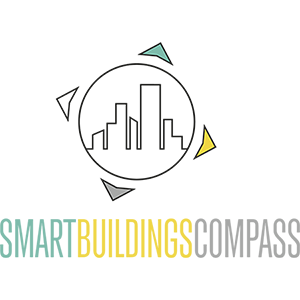Pflege ist häufig definiert als Sozialleistung, was jedoch einer sehr einseitigen Darstellung entspricht. Denn die Pflege ist auf so viele Arten Wirtschafts-, Standort-, Finanz- und Gesellschaftspolitik:
- Gute Angehörigen-Unterstützung erhöht die Erwerbsbeteiligung – besonders von Frauen, die den Großteil der Sorgearbeit zu Hause tragen. Eine gute Entlastung und Unterstützung reduziert Krankenstände, Teilzeitquoten und Fluktuation. Gute Pflegeunterstützung reduziert damit auch den Gender Pay Gap: Dadurch haben Frauen mehr Einkommen in ihrem gesamten Leben zur Verfügung und wir reduzieren die Armutsgefahr im Alter.
- Prävention, eine professionelle Kurzzeitpflege und gute (teil-)ambulante Unterstützungsangebote wie die Tagespflege vermeiden teure Akutaufenthalte. Menschen werden dadurch unterstützt, möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben zu können: Sicher und selbstbestimmt. Dazu braucht es nicht gleich die 24/7-Pflege – sondern eine, die sich an die Bedürfnisse der älter werdenden Bevölkerung anpasst.
Dieser Bedarf für alltagsnahe Hilfe, Koordination und Entlastung für Angehörige steigt mit der aktuell steigenden Zahl der PensionistInnen. Für Deutschland geht das Analyse-Institut Prognos davon aus, dass bis 2045 40% mehr Menschen auf Pflegepersonal angewiesen sein werden. In Österreich prognostiziert das WIFO-Institut eine um 57% steigende Anzahl der pflegegeldbeziehenden Personen bis 2050. Die Kosten für alle Pflegeleistungen in AUT erhöhen sich bis 2030 von 2,71 Mrd. EUR im Jahr 2021 auf rund 4,22 Mrd. EUR im Jahr 2030 (+56%) und etwa 10,7 Mrd. EUR (+294 %) bis 2050.
Da die Pflege zu Hause die günstigste Form im Vergleich zur Aufnahme in Pflegeorganisationen ist, werden die Systemkosten insgesamt gesenkt, wenn Menschen so lange wie möglich zu Hause gepflegt werden.
- Pflege schafft außerdem qualifizierte, lokale Jobs und befeuert die Innovation – von Digital Health bis hin zum barrierefreien, intelligenten Wohnbau. Die lokale Innovation ist am Gesundheits- und Pflegesektor besonders wichtig, weil es sich hier um sensible Daten handelt, die wir nicht in ausländischen Clouds verarbeitet wissen wollen.
- Und nicht zuletzt wirkt Pflege in die kleinsten Einheiten unserer Gesellschaft: In die Familien. Werden sie mit der Pflege nicht ausreichend unterstützt, erodiert das ohnehin dahinschmelzende Vertrauen in die öffentlichen Institutionen. Eine gute Unterstützung der Familien wirkt stabilisierend auf Parteien in der politischen Mitte: Da Menschen, BürgerInnen für das viele Steuergeld, das sie abgeben, ganz gerne Lösungen für ihre dringlichsten Probleme und Herausforderungen hätten. Und wenn sie diese erhalten, dann bei Wahlen eventuell nicht abdriften in die politischen Ränder.
Eigentlich sollte es relativ einfach sein, die Politik und ihre Finanz- und Controllingabteilungen von innovativen Projekten in der Pflege zu überzeugen, oder? Mitnichten.
Strategielosigkeit, Kürzungsorgien und Verteilungskämpfe
In der Praxis dominieren strategielose Kürzungspolitik und würdelose Verteilungskämpfe.
- Projekte werden nicht eingebettet betrachtet in die oben beschriebenen Zusammenhänge, sondern als reine Kostenfaktoren im eigenen kleinen Silo-Königreich. Was in einem anderen Budget langfristig für Entlastung sorgt, wird weggewischt: Dafür ist man nicht zuständig, um diese Herausforderung soll sich bitte jemand anderer kümmern. Entscheidungen werden in der eigenen Echokammer gefällt, ohne auf das große Ganze zu blicken und ohne auf die Ursachen einzuwirken.
- Unternehmen bangen trotz ihres Lösungsangebots um ihre wirtschaftliche Zukunft. Wenn es keinen Markt für ihre Produkte gibt und Bürokratie und Regelungen ihnen die Luft zum Atmen nehmen, verlassen diese Unternehmen entweder den europäischen Markt und widmen sich Märkten, die den roten Teppich ausrollen. Oder sie sterben einen leisen Tod.
- Auch ein alter Klassiker: Kammern verteidigen Besitzstände, Zugangshürden bleiben bestehen. Aktuellstes Beispiel: Apotheken und Hausapotheken in ärztlichen Praxen werden nicht nach tasächlichem Bedarf aufgebaut, sondern nach Abstand zur nächsten. Da geht’s um jeden Zentimenter. In der Praxis bauen ÄrztInnen ihre Zentren dann irgendwo am Acker, damit sie eine Hausapotheke integrieren können. Die oft zitierte „Schlapfennähe“ hat ja gerade für ältere Menschen großen Sinn.
In meinen Interviews zeigen sich regelmäßig die Folgen von einer kurzsichtigen Politik: Pflegende Angehörige brennen auf Grund der Belastung aus und werden selbst in jungen Jahren zu PatientInnen. Beratungs- und Unterstützungsangebote sind nicht ausreichend bekannt und werden daher nicht genutzt. Die finanziellen Belastungen in den Familien selbst für eine Basisversorgung nehmen kontinuierlich zu. Stationäre Einrichtungen sind auch deshalb überlastet, weil die nicht altersgerechte Wohnsituation und Lücken in der ambulanten Versorgung und im Betreuten Wohnen akute Notlagen provozieren. Selbst langjährige regionale Anlaufstellen für Erkrankungen wie Demenz fallen dem Rotstift zum Opfer.
Ältere Menschen würden dringend niederschwellige Unterstützungsangebote benötigen, um sich in der Komplexität von Bürokratie und Digitalisierung zurechtzufinden. Sie scheitern oft am Finden von Unterstützungsmöglichkeiten, am Ausfüllen von Anträgen, die nur online gestellt werden können. Und auch weil insbesondere am Land Strukturen wie Post, Bankfilialen und Lebensmittelhandel erodieren, brauchen ältere Menschen immer häufiger Unterstützungen in Form von Erwachsenenvertretungen – und auch diese Strukturen arbeiten bereits am Anschlag. Denn oft ist der Umstieg auf z.B. digitales Banking und Selbstbedienungsangebote einfach nicht mehr möglich. P.S.: Länder wie Ruanda schaffen es übrigens, die Bevölkerung in der Nutzung der E-Government Strukturen zu unterstützen – und nein, das ist kein Scherz, sondern bittere Realität.
Kurzsichtigkeit schafft langfristige Probleme
Ohne klare Strategie, ausreichendes Personal und gut organisierte Angebote geraten Familien, Kommunen und das Gesundheitssystem unter Druck. Eigentlich sollten Familien, die zu Hause pflegen, alle Unterstützung erhalten, um das möglichst lange zu schaffen. Weil alles andere viel, viel teurer ist. In der Realität stehen die pflegenden Angehörigen häufig allein da – mit endlosen Formularen, Wartelisten und der impliziten Botschaft, sich bitte selbst zu kümmern.
Und einmal mehr frage ich mich, wann der Kipp-Punkt erreicht ist: Wann werden Konzepte nach realer Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit zusammengestellt – und nicht nach alten Konzepten, (Besitzstands-)Regeln, Zugangshürden und starren Berufsrechten?
Author: Anja Herberth
Chefredakteurin