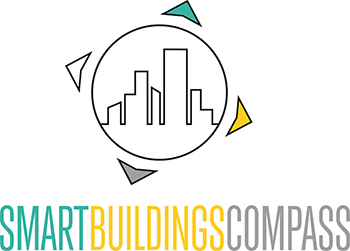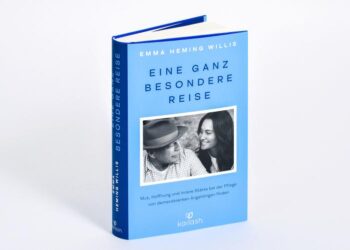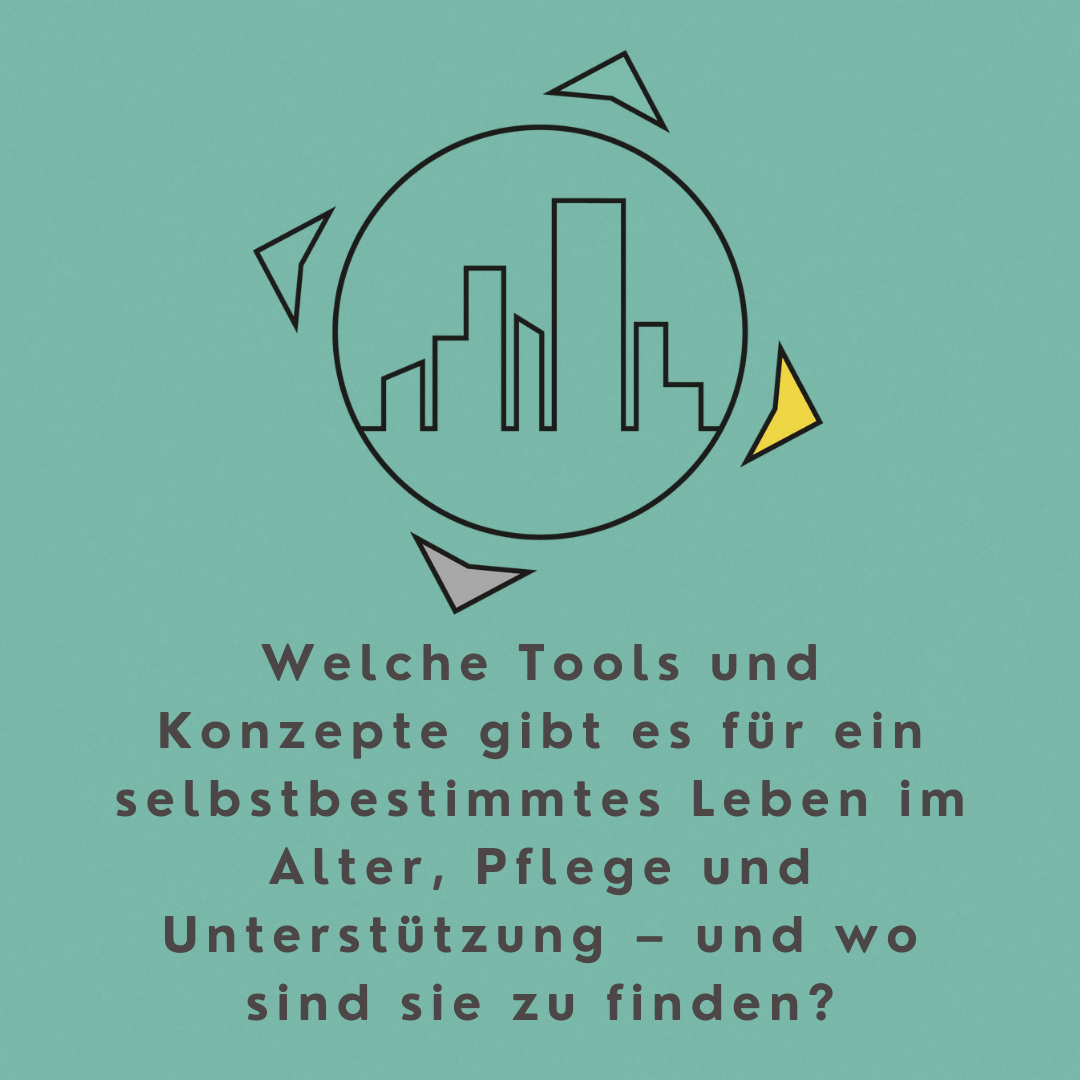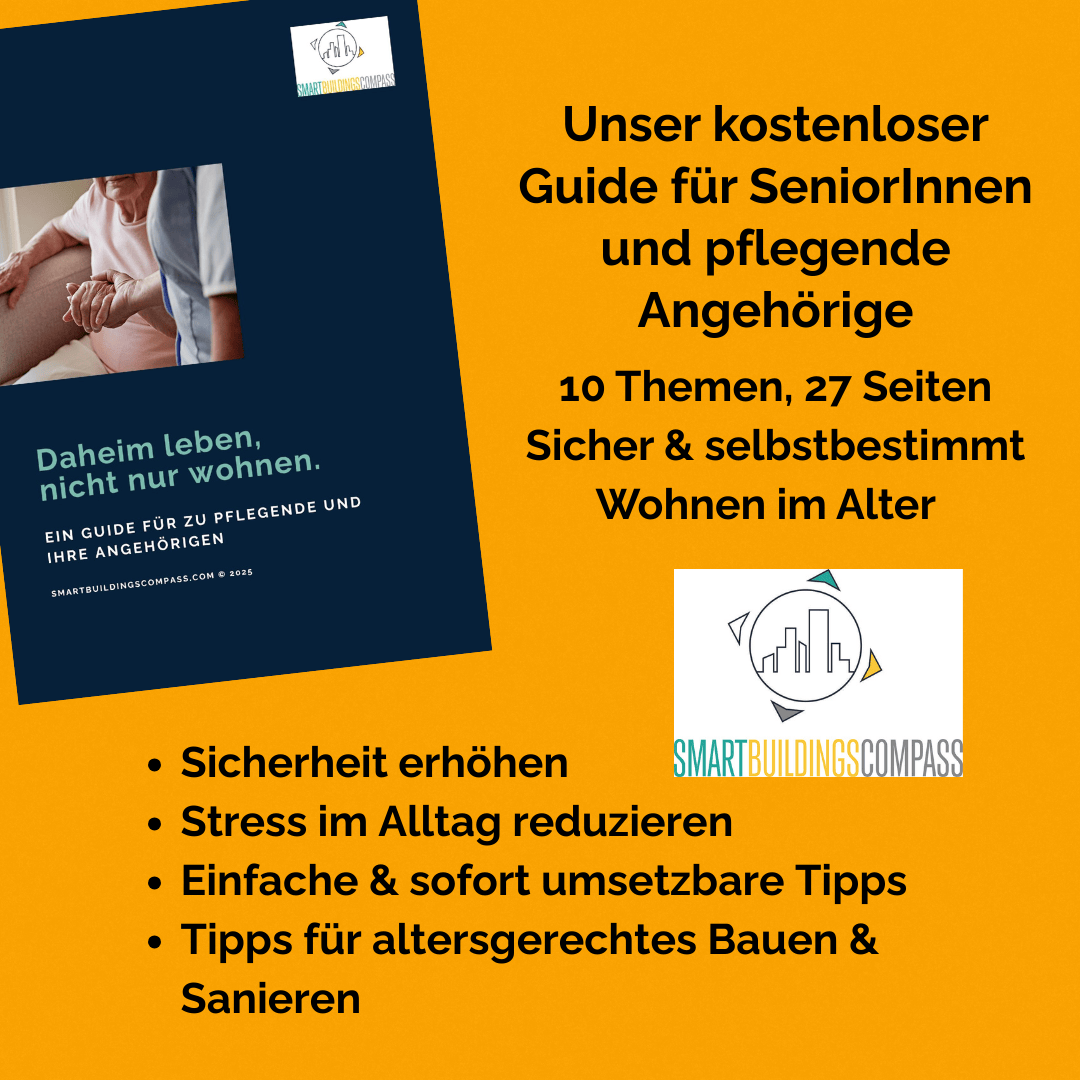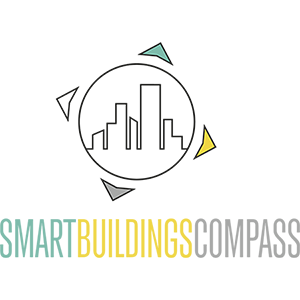This article is also available in:
English
Können Sie sich noch ein Leben ohne Smartphone und Computer vorstellen? Die Digitalisierung durchdringt bereits alle Lebensbereiche – von der Kommunikation über die Arbeitswelt bis hin zur Gesundheitsversorgung. Im Arbeitsleben, wie auch im Privatleben. Doch welchen Preis zahlen wir für den technologischen Fortschritt? Die Wissenschaft warnt: Die permanente rein berieselnde Nutzung digitaler Technologien beeinträchtigt unsere kognitiven Fähigkeiten und führt in der Zukunft zu einer Demenz-Welle.
In seinem Buch „Digitales Unbehagen: Risiken, Nebenwirkungen und Gefahren der Digitalisierung“ geht der bekannte Neurowissenschaftler und Psychiater Manfred Spitzer der gesundheitsgefährdenden Seite der digitalen Transformation auf den Grund. Er ist seit 1998 ärztlicher Direktor an der Universitätsklinik Ulm und hat die Gesamtleitung des dort 2004 eröffneten Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen.
Warum wir uns mit dieser Thematik auseinandersetzen?
Weil Spitzer gemeinsam mit internationalen Wissenschaftlern davon ausgeht, dass die exzessive Nutzung digitaler Medien zu einer dramatischen Zunahme von Demenzkranken führen wird. Die steigende Abhängigkeit von digitalen Systemen könnte dazu führen, dass Nutzer wesentliche kognitive und praktische Fähigkeiten verlieren. Das Gehirn ist auf regelmäßige geistige Herausforderungen angewiesen, um seine Leistungsfähigkeit zu erhalten. Durch die Automatisierung vieler kognitiver Prozesse – sei es durch Navigationssysteme, Sprachassistenten oder Algorithmen, die Entscheidungen abnehmen – entfällt ein wichtiger Stimulus für das Gehirn.
Über Jahre hinweg wurde der Wissenschaftler für diese Aussage angegriffen. Heute wissen wir: Er hat recht. Die digitale Demenz ist heute ein offiziell anerkanntes Krankheitsbild. Studien belegen, dass es tatsächlich zu einer dementen Erkrankung kommt, wenn das Gehirn nicht mehr richtig benutzt wird.
Wie sinnlose Berieselung unser Denken verändern
Verlieren wir durch die Digitalisierung unseren Verstand, unser Denkvermögen? Laut der Deutschen Alzheimer Gesellschaft lebten Ende 2023 in Deutschland rund 1,8 Millionen Menschen mit Demenz. In Österreich sind laut Schätzungen zwischen 130.000 und 150.000 Menschen von dieser Krankheit betroffen. Demenz, das ist auf Latein der Abstieg des Geistes, ist die Erosion der Persönlichkeit, des Gedächtnisses und der Sprachfähigkeit. Wir verlernen zu gehen, zu essen. Wir verdanken die Steuerung unseres Körpers unserem Geist. Und wenn sich dieser langsam verabschiedet, verlieren wir quasi unsere Festplatte – um bei einem digitalen Begriff zu bleiben.
Die WHO geht davon aus, dass sich die heutigen Zahlen bis 2050 verdoppeln werden. Kanadische Psychologen meinen: Die Zahl wird sich vervier- bis versechsfachen. Denn die WHO stütze sich auf Erfahrungen mit Meschen, die ihre Jugend in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts verbracht haben. Und da gab es noch keine digitalen Medien. Da wurden Bücher gelesen, der Tag spielend in der freien Natur verbracht. Bei diesen Tätigkeiten hat sich, so Spitzer, „etwas verdrahtet“, unser Gehirn hat dadurch gelernt. In der passiven Nutzung des Smartphones und Tablets verdrahtet sich – durch Studien nachgewiesenermaßen – nichts.

Ein zentraler Aspekt von Spitzers Analyse sind daher die langfristigen Auswirkungen der digitalen Demenz. Der Neurowissenschaftler beschreibt, wie die permanente Nutzung digitaler Technologien unsere kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt. Und zwar nicht mit den digitalen Tools arbeitend, sondern in den sozialen Medien versinkend. Sich mit Videos aus Facebook und Tiktok berieseln lassen. Unser Hirn, so Spitzer, verändert sich mit seiner Benutzung. Und wenn es nur berieselt wird, ist es zu nicht viel anderem fähig.
Kinder und Jugendliche: Für eine gute Ausgangsbasis sorgen
Wie bei so vielen anderen Themen gilt auch hier: Die Dosis macht das Gift. Er argumentiert, dass exzessiver Medienkonsum – insbesondere bei jungen Menschen – das Gehirn daran hindert, grundlegende Denkleistungen wie Merkfähigkeit, kritisches Denken und Problemlösung eigenständig zu entwickeln. Gerade bei Kindern und Jugendlichen plädiert er daher für ein Training des Hirns ohne Smartphones, Tablets & Co. Spitzer zieht Parallelen zwischen der digitalen Demenz und den Auswirkungen körperlicher Inaktivität auf die Muskulatur: Wer sich kaum bewegt, baut Muskeln ab – und wer sein Gehirn nicht aktiv fordert, verliert geistige Fähigkeiten.
Besonders gefährlich sei dies für Kinder und Jugendliche, deren Gehirne sich noch in der Entwicklungsphase befinden. Er verweist auf Studien, die zeigen, dass ein übermäßiger Konsum digitaler Medien mit einer reduzierten Aktivität in den für Gedächtnis und Lernen zuständigen Gehirnarealen korreliert. Er warnt vor Aufmerksamkeitsstörungen: Die ständige Ablenkung durch digitale Reize führt dazu, dass das Gehirn weniger tiefgehende Lernprozesse durchläuft. Dies beeinträchtigt nicht nur das Kurzzeitgedächtnis, sondern kann auch die langfristige kognitive Leistungsfähigkeit schwächen.
Dies könne langfristig nicht nur die schulische Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, sondern auch das Risiko für spätere demenzielle Erkrankungen erhöhen. Ein besser trainiertes Gehirn schützt vor geistigem Verfall. Denn unsere Nervenzellen gehen kaputt, wenn wir alt werden. Ein gut geschultes und trainiertes Hirn steigt von einem höheren Berg ab, und der Abstieg dauert länger. Mangelndes Training bedeutet, dass von einem weniger hohen Berg herabgestiegen wird.
Die Politik ist mittlerweile auf diese Problematik aufmerksam geworden: In Schweden wurden die digitalen Schulbücher wieder abgeschafft und „echte“ Schulbücher wieder eingeführt. In Frankreich sind Smartphones erst ab 13 Jahren, Social Media erst ab 17 Jahren erlaubt. In den USA haben einige Bundesstaaten Maßnahmen ergriffen, um die Nutzung sozialer Medien für Minderjährige altersmäßig einzuschränken.
Eine polarisierende Analyse mit Diskussionspotenzial
Spitzers Buch ist ein wichtiger Weckruf für alle, die sich mit der Digitalisierung beschäftigen – sei es im privaten, beruflichen oder gesellschaftlichen Kontext. Kritiker werfen ihm jedoch vor, eine einseitig negative Sichtweise zu vertreten, ohne die Chancen der Digitalisierung ausreichend zu würdigen. Gerade für Branchen wie Smart Buildings, in denen technologische Innovationen viele Vorteile bieten, wäre ein differenzierterer Blick wünschenswert.
„Digitales Unbehagen“ ist ein provokantes, aber lesenswertes Buch, das zum Nachdenken über den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Technologien anregt. Die Debatte über digitale Demenz ist besonders relevant, da sie weitreichende Folgen für unsere Gesellschaft und zukünftige Generationen haben könnte. Wer sich für die Auswirkungen der Digitalisierung auf kognitive Fähigkeiten interessiert, findet hier wertvolle Denkanstöße – und sollte Spitzers Thesen kritisch reflektieren, um daraus die richtigen Schlüsse für eine ausgewogene digitale Zukunft zu ziehen.
Quellen:
- Buch: „Digitales Unbehagen – Risiken, Nebenwirkungen und Gefahren der Digitalisierung“ von Manfred Spitzer
- Podcast von thepioneer.de, Gabor Steingart im Gespräch mit Manfred Spitzer: „Wir müssen den Einfluss durch TikTok, Insta und Co. auf Jugendliche einschränken“
Author: Anja Herberth
Chefredakteurin