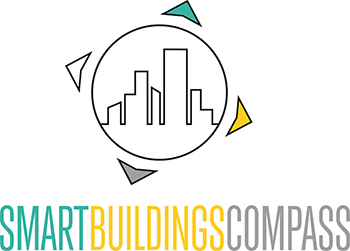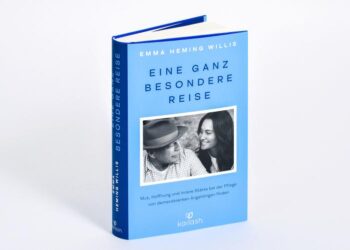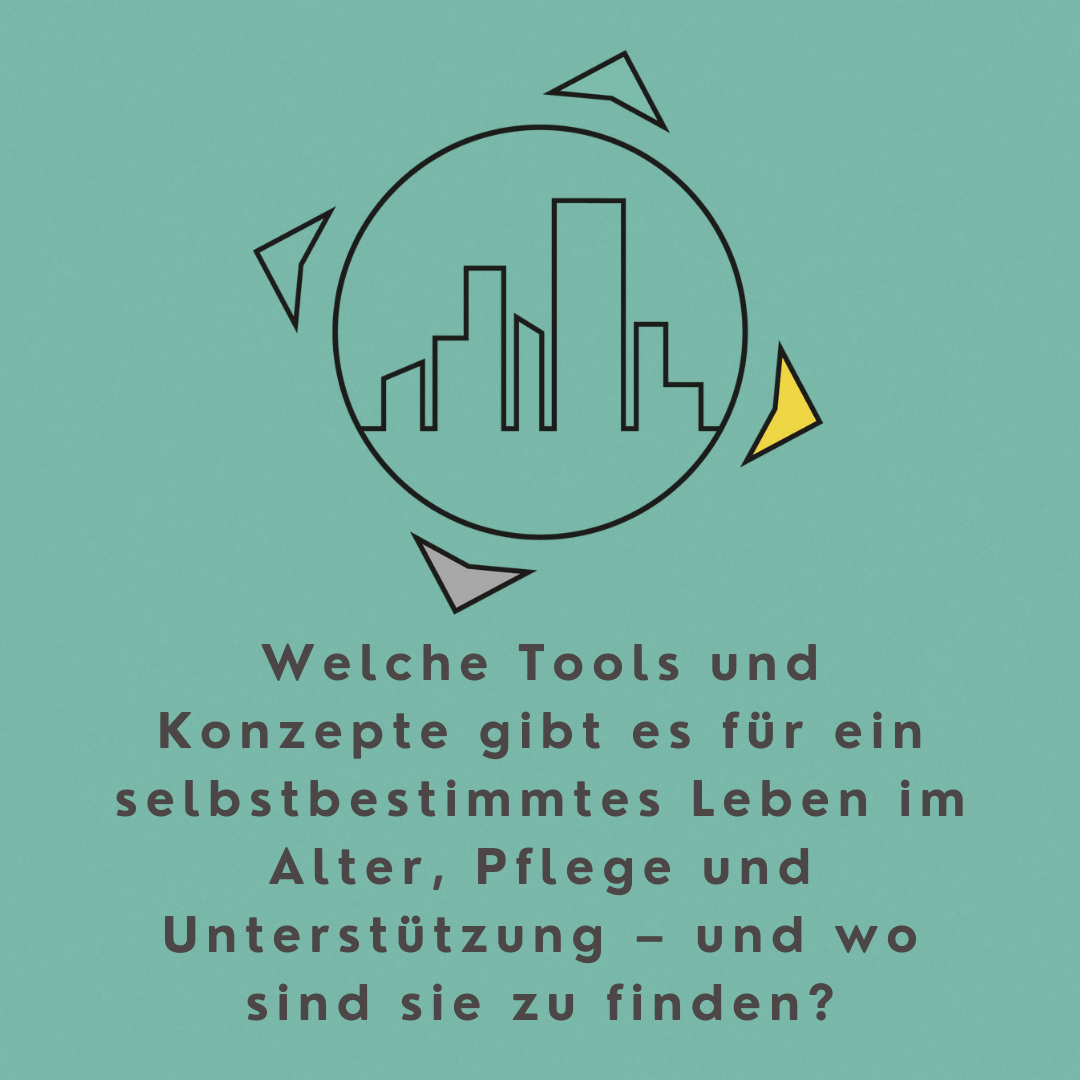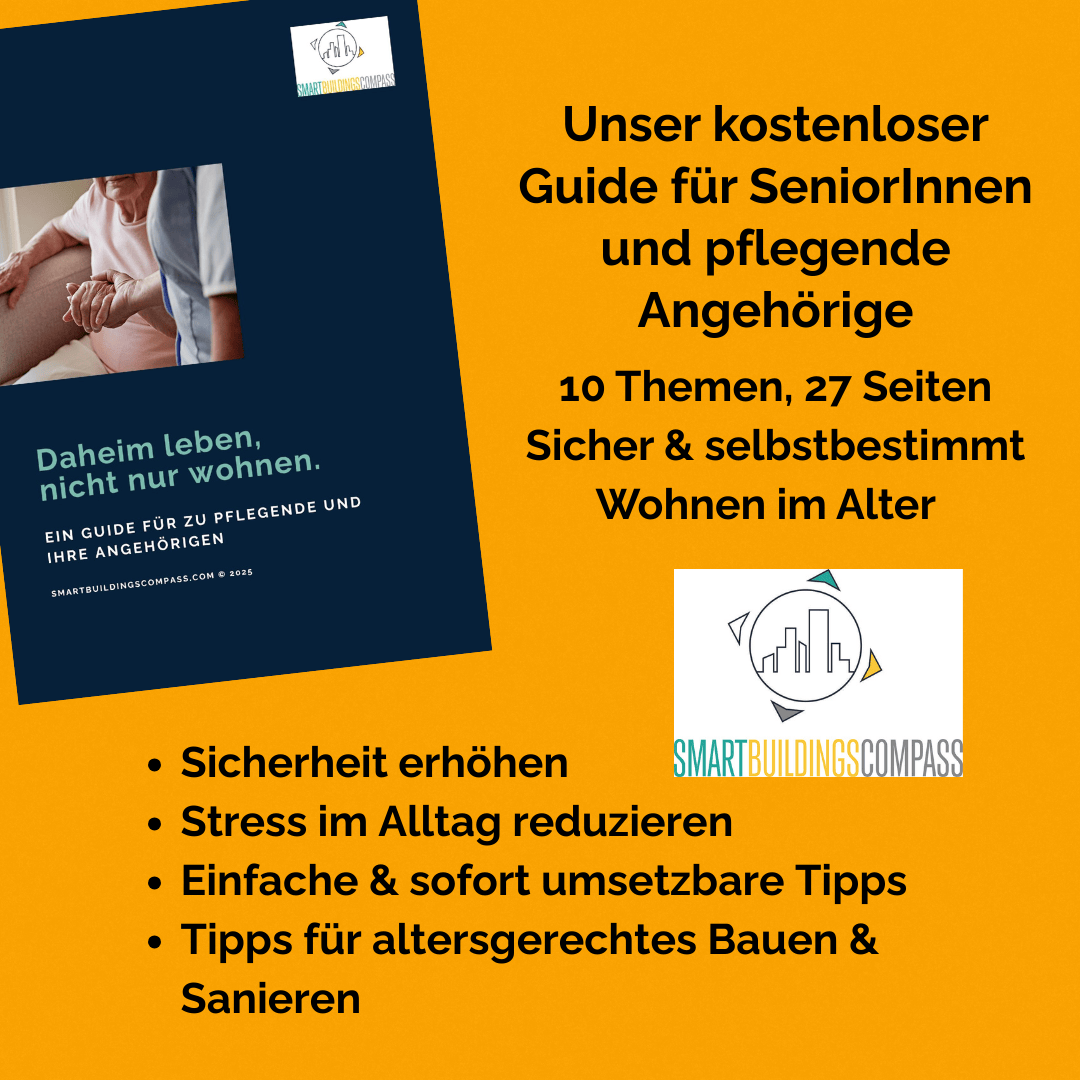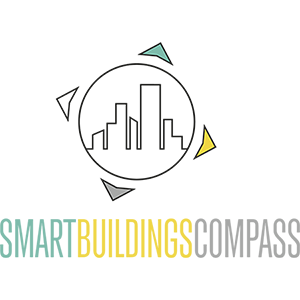This article is also available in:
English
Die alternde Bevölkerung Europas bringt eine Herausforderung mit sich: Immer mehr Menschen sind im höheren Lebensalter von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen. Laut einer aktuellen Übersicht von The Lancet Regional Health – Europe sind ältere Erwachsene nicht nur überproportional belastet, sondern erhalten auch seltener die optimale Behandlung.
Warum ältere Menschen nicht optimal behandelt werden
Mit dem Alter steigen nicht nur die Risiken für Herzinfarkt, Schlaganfall oder Herzinsuffizienz, sondern auch die Komplexität der Behandlung. Viele PatientInnen leiden unter mehreren Erkrankungen gleichzeitig, müssen zahlreiche Medikamente einnehmen und sind anfälliger für Nebenwirkungen. Dazu kommen altersbedingte physiologische Veränderungen und häufig auch kognitive Einschränkungen.
In dieser Komplexität gibt es zu wenige Daten und Leitlinien, auf die sich ÄrztInnen in der Behandlung stützen können. Denn in klinischen Studien sind Menschen über 75 Jahre stark unterrepräsentiert. Viele Therapien beruhen auf Daten jüngerer Patientengruppen, sodass für ältere Menschen evidenzbasierte Empfehlungen fehlen. Die Folge: Leitlinien greifen zu kurz und ältere PatientInnen erhalten oft weniger intensive oder verzögerte Behandlungen.
Neben den medizinischen Faktoren verstärken auch soziale Ungleichheiten die Risiken. Finanzielle Einschränkungen, eingeschränkter Zugang zu Gesundheitsdiensten – insbesondere in ländlichen Regionen – sowie soziale Isolation erschweren eine kontinuierliche Versorgung. Studien zeigen, dass ältere Erwachsene mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen häufiger einsam sind und dadurch ein zusätzlich erhöhtes Risiko für Verschlechterungen haben.
Auch gibt es immer mehr Hochbetagte und Gebrechliche: Fast jede dritte Person über 85 ist davon betroffen. Das bedeutet, dass Körper und Kräfte schwächer werden. Die Betroffenen sind anfälliger für Komplikationen, Stürze und schwerere Krankheitsverläufe.
Was Herzerkrankungen mit Demenz zu tun haben
Herzerkrankungen und Demenz hängen eng zusammen. Wer ein schwaches Herz hat, hat auch ein höheres Risiko für Gedächtnisprobleme – und umgekehrt. So wird die vaskuläre Demenz durch eine Veränderung der Durchblutung im Gehirn ausgelöst. Warum das so ist: Das Herz versorgt das Gehirn über die Blutgefäße mit Sauerstoff und Nährstoffen. Wenn Herz oder Gefäße erkrankt sind, wirkt sich das direkt auf die Gehirngesundheit aus. Bluthochdruck, Arteriosklerose oder Herzrhythmusstörungen können zu Gefäßschäden im Gehirn führen, die eine Demenz begünstigen.
Bei einer Herzschwäche wird weniger Blut ins Gehirn gepumpt, wodurch die Nervenzellen nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Auch Schlaganfälle, die häufig eine Folge von Vorhofflimmern oder Gefäßproblemen sind, gelten als wichtiger Risikofaktor für Demenz. vaskulären Demenz erkranken. Diese ist die zweithäufigste Form der Demenz und für etwa 25 Prozent der Fälle verantwortlich.
Hinzu kommt, dass Risikofaktoren wie Rauchen, Diabetes, Übergewicht oder Bewegungsmangel sowohl Herz als auch Gehirn schädigen. Studien zeigen daher deutlich: Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben ein erhöhtes Risiko, an Demenz zu erkranken. Umgekehrt erschweren kognitive Einschränkungen oft die Behandlung von Herzerkrankungen. Einfach gesagt: Ein gesundes Herz schützt auch das Gehirn – deshalb müssen Herztherapie und Demenzprävention immer gemeinsam gedacht werden.
Die Empfehlungen der Expertinnen
Ein gesunder Lebensstil wird – wenig überraschend – auch in dieser Studie als zentral hervorgehoben. Sie betont, dass Lebensstiländerungen auch im hohen Alter noch Wirkung zeigen: Ein Rauchstopp verlängert die Lebenserwartung messbar, eine nährstoffreiche Ernährung wirkt Bluthochdruck und Diabetes entgegen. Regelmäßige Bewegung – auch moderate Aktivität wie Spaziergänge – senkt das Risiko für Stürze, verbessert die Herzfunktion und steigert die Lebensqualität.
Die WHO empfiehlt daher älteren Erwachsenen mindestens 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche sowie gezielte Kraft- und Gleichgewichtsübungen. Doch laut europäischen Daten erfüllt nur ein kleiner Teil der über 65-Jährigen diese Empfehlungen.
Aus Sicht der StudienautorInnen reicht es angesichts der Zusammenhänge nicht mehr aus, bei älteren PatientInnen nur die Krankheit selbst zu behandeln. Die Versorgung muss viel stärker darauf ausgerichtet sein, Lebensqualität, Selbstständigkeit und Alltagstauglichkeit zu erhalten.
Die Lancet-Kommission schlägt eine Reihe konkreter Maßnahmen vor, um die Versorgung älterer Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verbessern. Wichtig sei vor allem eine enge Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen: Herzspezialisten, Altersmediziner und Hausärzte sollen gemeinsam individuelle Strategien für ihre PatientInnen entwickeln. Auch die Behandlung mit Medikamenten muss stärker angepasst werden, da ältere Menschen häufig viele Medikamente gleichzeitig einnehmen und empfindlicher auf Dosierungen reagieren. Ebenso zentral, so die ExpertInnen, ist eine konsequente Vorbeugung, die Schutzimpfungen – etwa gegen Grippe –, Ernährungsberatung, Bewegungsprogramme und Hilfen beim Rauchstopp einschließt. Damit künftige Empfehlungen noch passender werden, sollten ältere Menschen außerdem gezielt in medizinische Studien einbezogen werden. Schließlich braucht es mehr soziale Unterstützung, damit Angehörige und Pflegekräfte entlastet werden und die Betreuung langfristig gesichert ist.
Heißt: Ein ganzheitlicher Ansatz, der Medizin, Vorbeugung, soziale Faktoren und Lebensqualität zusammenführt, ist entscheidend, um die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft zu meistern. Doch noch immer klaffen Lücken zwischen den medizinischen Möglichkeiten, den Leitlinien und der Realität älterer PatientInnen.
Mehr dazu lesen:
Author: Anja Herberth
Chefredakteurin